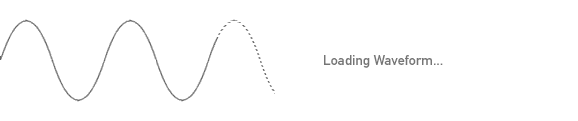Glosse über den unerträglichen Druck, Entscheidungen zwischen zwei Möglichkeiten treffen zu sollen, obwohl man eigentlich die Fragestellung selbst als nicht legitim ansieht.
(Erscheint im Druck in akin 25/2012)
*
Gut und Böse
Es ist wiedermal soweit — in Palästina/Israel krachts. Und wieder
stellen sich alle in Chor und Gegenchor auf. Auf Facebook kommen die
Bilderbotschaften. Die einen sagen: «Böse Israelis — Solidarität mit
Palästina!» Und die anderen: «Böse Palästinenser — Solidarität mit
Israel!» Wenn irgendjemand sagt, daß das im Sinne des Friedens nicht
hilfreich wäre, kommt das Zitat: «Hinter dem Ruf nach Frieden
verschanzen sich die Mörder.» Das hat ein früherer Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden in Deutschland gesagt — hätte aber auch
genauso gut von einem Araber stammen können. Motto: «Wenn du nicht für
mich bist, bist du gegen mich.» Und dazu kommen dann die Bilder von
israelischen Kindern und palästinensischen Kindern und ich soll empört
sein über jeweils eine bestimmte Seite — und nicht etwa darüber, daß
dieser Konflikt ständig auf beiden Seiten Menschenleben kostet.
Differenzierte Ansichten, die vielleicht irgendwie dem Verständnis
eines Konflikts hilfreich sein könnten? Fehlanzeige — in der realen
Welt genauso wie in den elektronischen Netzwerken! Wir können gerne
diskutieren, wer schuld an dem Schlammassel ist. Aber hilft das
irgendjemandem, der an einer Konfliktlösung interessiert ist? Kaum.
Der Umgang mit diesem Konflikt ist ein katastrophaler. Er zeigt aber
einen Mechanismus auf, der auf einem Mißstand beruht, der leider auch
(und vielleicht sogar: vor allem) in der Linken weit verbreitet ist:
Die Unfähigkeit zur Dialektik. Vielleicht ist gerade das klassische
Widerspruchsdenken, also das Denken in eindeutig zuordenbaren
Konfliktparteien, wie es durch den Widerspruch unter anderem zwischen
Kapital und Arbeit geprägt ist, eine Grundlage eben dieser
Unfähigkeit. Es interessiert niemanden eine Synthese, es gibt nur
These und Antithese, der Hegelsche Dreisprung findet nicht statt. Von
der Idee, daß vielleicht schon die Ausgangsthese grundlegend falsch
war und die Antithese damit auch, brauchen wir da gar nicht zu
reden…
Dieses Muster kehrt immer wieder. Ich kann mich gut erinnern an den
Bosnienkrieg, wo man sich innerhalb der Friedensbewegung einig
glaubte, daß es wichtig sei, ohne Schuldzuweisungen die Frage zu
stellen, wie man denn die friedensorientierten Gruppen in der Region
unterstützen könnte — und plötzlich ging die Debatte los, ob nicht
vielleicht doch «die Serben» die Bösen seien. Weil: Schließlich
braucht man ja doch einen Schuldigen. Und der muß natürlich genau den
Mustern entsprechen, die vom common sense vorgegeben werden: Nicht
etwa die Warlords oder die Waffenhändler oder bestimmte Regierungen
mit vitalen Interessen, nein, ein ganzes Volk muß daran schuld sein
und alle anderen können nichts dafür. Nicht einmal das wird wirklich
hinterfragt. Und selbst wenn es hinterfragt wird, ist das oft genug
wenig hilfreich. Denn das Prinzip von Schuld und Sühne war noch selten
in der Geschichte dazu angetan, die Zukunft besser zu gestalten.
Natürlich kann man sich da auch dem Vorwurf aussetzen, die Welt ahistorisch zu betrachten, wenn man so argumentiert wie ich nun. Doch wenn Geschichte nicht zum Zweck der Erkenntnis eingesetzt wird und niemand wirklich aus ihr lernen will, sondern es nur darum geht,
leicht handhabbare Totschlagargumente aus ihr abzuleiten, dann hilft
uns Geschichte nicht weiter. Wenn mir jemand sagt, man müsse aus der
Geschichte lernen, werde ich gleich vorsichtshalber aggressiv, weil
ich annehmen muß, daß jetzt ein Vortrag kommt von jemandem, der genau
gar nichts aus der Geschichte zu lernen bereit ist, sondern lediglich
ein paar Versatzstücke braucht, um sein Arsenal aufzufüllen.
Das Denken in Antagonismen ist leicht. Und das Schönste daran: Man
kann sie so schön moralisch ausfüllen, daß man sich nachher richtig
gut fühlen kann — als Mensch mit Prinzipien eben. Hoch die
Solidarität mit… eh scho wissn! Wer ein Gewissen haben will, braucht
auch eine Fahne. Oder so.
Dieses Muster setzt sich allerdings auch außerhalb kriegerischer
Auseinandersetzungen fort. Ich denke da an die Debatte über die
Europäische Union. Warum muß man gleich in den Chor der
Österreich-Patrioten eingemeindet werden, wenn man die EU als Moloch
ansieht? Warum muß man zum EU-Fan mutieren, wenn man die
österreichische Kleingeistigkeit kritisiert? Warum soll ich mich
zwischen einem österreichischen und einem europäischen Vaterland
entscheiden? Ich brauch kein Vaterland! Und ich brauch auch keine
Hymne, nicht mal eine gendergerechte, wenn ich diesen schwülstigen
Singsang, der einzig und allein zum Zwecke des Strammstehens tradiert
wird, so oder so für verzichtbar halte.
Diese Grundhaltung, sich entscheiden zu wollen, welche Position von
zwei — von einem hegemonialen Diskurs vorgegebenen — Möglichkeiten
denn nun die richtige sei, anstatt die Frage selbst erst einmal auf
ihre Legitimität zu prüfen, zieht sich durch die gesamte Gesellschaft
in Österreich und wohl auch im Rest der Welt. Aber gerade die Linke
läßt sich in ihrer Sehnsucht nach klaren Frontstellungen, wo klar
scheint, gegen wen man ins letzte Gefecht zu ziehen habe, immer wieder
dazu hinreissen, Fragen zu beantworten, deren Sinnhaftigkeit erst
einmal hinterfragt werden müßte.
Die Welt ist kompliziert. In Österreich wurde ein Bundeskanzler
verlacht, weil er genau dies festgestellt hatte. Er galt als schwach,
weil er ein um Ausgleich und Differenzierung bemühter Intellektueller
war. Doch solange wir die plumpe Akzeptanz vorgegebener Dichotomien
für ein Zeichen von moralischer Stärke halten, werden wir diese Welt
wohl kaum verbessern.
Bernhard Redl