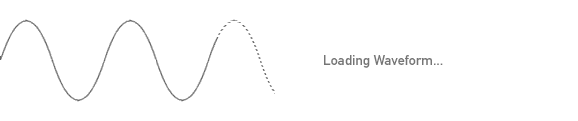Die Familie
Ort des Glücks,
Ort der unbezahlten Arbeit,
Ort des Psychoterrors,
Ort des Amoklaufs
Die Kultur der Übergriffigkeit
Frauen sehen sich einem Dominanzanspruch von Männern, anzüglichen Bemerkungen, „Witzen“, aggressiver Anmache und Angrapscherei bis hin zu schwerer sexueller Gewalt ausgesetzt. Die Zeitungen sind voll davon – und von Klarstellungen der Art, dass sich dieses Verhalten überhaupt nicht gehört. Aber wenn, weit über die Minderheit bekennender Machos hinaus, Männer dennoch nicht von solchen Ansprüchen gegenüber Frauen lassen, zu denen sie kein Arbeitgeber und kein Staat ermuntert oder berechtigt, dann muss es dafür wohl Gründe geben, die man besser nicht auf die Natur, auf die Hormone, die lange Tradition oder die schlechten Beispiele aus anderen Kulturen schiebt.
Die Familie: Gemeinsame Bewältigung der Reproduktionsnotwendigkeiten …
Die Geschlechterrollen, das sexuelle Anspruchsdenken der Männer und auch die Anpassungsbereitschaft der Frauen und die dazugehörigen Sitten haben eine sehr gegenwärtige Basis in der modernen Familie bzw. „Beziehung“. Niemand zwingt Frauen und Männer, zu heiraten, der Staat nicht und nicht einmal mehr der Anstand. Sie tun es, weil die Ehe oder eine eheähnliche Beziehung die ziemlich vorgezeichnete Lebensform für Leute ist, die erstens den Tag über für Geld arbeiten, die zweitens nach der Arbeit viele Notwendigkeiten des Alltags abzuwickeln haben und die drittens auch einen menschlichen Umkreis, eine „Ansprache“ am Abend haben wollen. Gemeinsam meistern Paare das Leben, organisieren sich mit wenig Zeit und Kraft und Geld ein Privatleben samt Fürsorge für Kinder, das vor allem auf die Sphäre außerhalb bezogen ist: Es muss sie instand setzen, am nächsten Tag und auf Dauer wieder für die Erwerbsarbeit antreten zu können. Das Leben außerhalb der Arbeit ist funktionale Reproduktion für die Arbeit, ist geradezu deren Anhängsel. Aber wer sieht das schon so?
(Wenn sonst niemand, der Staat sieht die Sache sehr wohl so: Das Familienrecht regelt die Ansprüche und Pflichten für Verheiratete und Nichtverheiratete auch über die Dauer der Ehe hinaus mit dem Ziel, der sozialen Keimzelle den Aufwand für die Reproduktion der Arbeitskraft aufzuhalsen.)
… und ihr höherer Sinn: Entschädigung für die Härten des Arbeitslebens
Kapitalistische Erwerbstätige, die keine dienstbaren Knechte sind, sondern die ganz frei nach ihrem persönlichen Erfolg streben, die ein Recht auf ihren persönlichen Nutzen haben – die legen sich das Verhältnis von Arbeit und Freizeit umgekehrt zurecht: Nach der Arbeit und mit dem verdienten Geld sind sie endlich soweit, sich ihr Leben einzurichten, wie es ihnen und nur ihnen gefällt. Die Arbeit, die sie im Dienst an fremden Interessen gegen Geld ableisten, die den größeren Teil der Lebenszeit absorbiert, die sie verschleißt und die der Freizeit die Funktion der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zuweist – die akzeptieren sie als ein notwendiges Reich der Mühen, als notgedrungenen Aufwand für den folgenden Genuss und die frei gewählten Zwecke, die im kleineren Rest des Tages unterzubringen sind. Gegen die Objektivität bestehen moderne Menschen darauf, dass die Arbeit nur Mittel, die Freizeit aber Zweck und Lohn aller Mühen ist. Damit weisen sie der ohnehin gar nicht so freien Zeit eine Funktion zu, die sich gewaschen hat: Sie muss für das Opfer, das die Erwerbsarbeit ist, entschädigen und gleich noch den Beweis erbringen, dass diese Anstrengung sich insgesamt im Sinn eines gelungenen Lebens „lohnt“. Die Freizeit, speziell die Sphäre der privaten Zweisamkeit, wird mit einer kaum zu bewältigenden Aufgabe befrachtet, nämlich die Gesamtbilanz des Lebens ins Positive zu wenden. Im anerkannten Bedürfnis nach „work-life-balance“ zieht einen die Erwerbstätigkeit ziemlich runter – das Privatleben muss dann richten, insgesamt und überhaupt.
Zufrieden mit sich und der Welt zu werden, das wird als ein selbständiger Zweck der Freizeit verfolgt. Das ist insofern etwas abseitig, weil die Sphäre von Leistung und Lohn, in der sich tatsächlich entscheidet, was man vom Leben hat, für die generelle Zufriedenheit mit sich und der Welt nicht viel hergibt. Das Privatleben soll liefern, was das Leben so alles bieten muss, um nicht zu den Unglücklichen und den Versagern zu gehören, denen man auch begegnet. Eine positive Bilanz insgesamt verlangt man sich und seiner menschlichen Umgebung ab, ohne dass sich an Lohn und Leistung was ändern müsste. Den Beweis, dass man diesen Erfolg auch hinkriegt, den hat man schwer nötig und präsentiert ihn vor sich selbst und noch mehr vor der Welt – die Fortsetzung zu Angeberei und Selbstbetrug inbegriffen. Mit dem Recht auf und der Pflicht zum Glück wird auch das Privatleben zum Feld einer sehr anstrengenden Bewährung.
Liebe und Ehe – Die kompensatorische Gegenwelt zur Konkurrenz
Die erste Station der Bewährung besteht darin, jemanden zu finden und dauerhaft an sich zu binden. Beim naiven Sich-Verlieben, der unmittelbar empfundenen Zuneigung zu einer anderen Person, bei dem Gefühl eben, das alle Illustrierten und Filme als das wahre, aber leider sehr unbeständige und flatterhafte Glück preisen – dabei kann es eine Partnerwahl, bei der ein Mann oder eine Frau gleich fürs Leben gesucht werden, nicht belassen. Sich den Passenden oder die Passende zu angeln, ist ein mit viel Ernst verfolgtes seriöses Lebensprogramm, das ein (eventuell) geliebtes Wesen gleich unter ziemlichen Ansprüchen ins Auge fasst.
Wenn die Suche erfolgreich war, gehen die Heiratswilligen mit der Ehe eine Bindung ein, die von der Liebe unabhängig sein soll: ein gewolltes, sittliches hochwertiges Verpflichtungsverhältnis. Darüber täuschen sie sich nicht, und auch nicht darüber, dass die Verpflichtung in ein Müssen ausartet, wenn das Wollen nicht oder nicht mehr gegeben ist. Dass es sich um eine wechselseitige Verpflichtung handelt, soll den Zwangscharakter entschärfen – das tut es aber nicht. Diese Pflicht versprechen die Brautleute nicht nur einander, sondern bei der Trauung der ganzen religiösen oder politischen Community. Sie wissen ihre Zweisamkeit damit im Einklang mit der Konvention der Gesellschaft, mit der guten und deswegen allgemein verständlichen Sitte. Sie wissen ihr individuelles Leben mit seinen Ansprüchen und Erwartungen durch die Übereinstimmung mit gesellschaftlich gebilligten Prinzipien aufgewertet.
Für dieses ihr Lebensglück schaffen sich die Partner eine private Gegenwelt zu der Konkurrenz der Interessen und Gegensätze in der Arbeit, in der sie sich außerhalb ihrer Zweisamkeit täglich bewähren müssen und bewähren wollen, um sich ihr Nest überhaupt leisten zu können. Sie verzichten untereinander aufs Kaufen und Zahlen, teilen Geld und Hausarbeit. Zwischen ihnen soll der Mensch nicht nach Leistung und Erfolg taxiert werden, sondern unmittelbar, „so wie ich bin“ Anerkennung finden, d.h. dann: geliebt werden. Man möchte sich beim Partner nicht erst durchsetzen müssen, sondern unaufgefordert, sogar unausgesprochen Verständnis finden für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Die sind normalerweise nicht sehr originell, sondern durch die familiäre Arbeitsteilung vorgegeben; eine Arbeitsteilung, von der heute viele Paare mit schlechtem Gewissen sagen, sie sei diskriminierend und eigentlich überlebt, die sie unter dem Druck der Umstände gleichwohl reproduzieren: So ist nach wie vor häufig Er zuständig für die Beschaffung des nötigen Geldes; schon weil Männer nicht selten mehr verdienen. Dafür erwartet er, dass Sie Haushalt und Kinder managt und für sein leibliches und seelisches Wohl am Feierabend geradesteht. Sie erwartet Anerkennung und Zuwendung und Mithilfe im Haushalt, schon gleich, wenn auch sie arbeiten geht. Eheleute stellen sich den geteilten Aufgaben und wollen es einander recht machen, füreinander da sein. Sie identifizieren sich mit ihrem Partner und identifizieren auch ihn, mit den eigenen Erwartungen an ihn.
Dass diese Erwartungen häufig Zumutungen sind und nicht selten enttäuscht werden, liegt am Maßstab, den die Partner an ihr Privatleben und deshalb aneinander anlegen: Der andere soll, was er mit einem Beitrag zum Familienleben und auf Dauer nicht kann, nämlich die Anstrengungen des Lebens außerhalb der Familie bedeutungslos machen, dennoch die umfassende Befriedigung der eigenen Individualität gewährleisten. Das Gelingen wie Misslingen dieses Programms der Kompensation wird nicht auf das bezogen, was da alles an Sorgen des Alltags kompensiert werden soll und womit, sondern auf den Partner: Widrigkeiten, die der Mangel an Geld und Zeit und Kraft mit sich bringt, werden als unzureichender Einsatz des anderen für die häusliche Gemeinschaft und als fehlende Bereitschaft gedeutet, alle sonstigen Interessen zu streichen. So gerät der Wille zur glückbringenden Gegenwelt zu einem wechselseitigen Fordern und Dienen; und gerade bei Paaren, die dem Bestand ihrer Ehe alles unterordnen, zu einem Austausch von Selbstlosigkeit voller Berechnung. Sehr dialektisch: Gerade durch die eigene Selbstlosigkeit soll das Selbst auf seine Kosten kommen. Mit den eigenen Diensten an den Notwendigkeiten und Bedürfnissen des Partners klagt man seinen Anspruch auf dessen Dienste ein, die man mehr als verdient zu haben meint.
Die Erwartungen an den Partner sind durch die eigenen Leistungen und durch die feierliche sittliche Verpflichtungserklärung längst Rechtsansprüche, sie zu erfüllen ist Liebespflicht. Und wenn der Partner seinen Teil zum gemeinsamen Wohlbefinden schuldig bleibt, dann zerstört ausgerechnet der eine Mensch, der für das eigene Glück zuständig ist, dieses hohe Gut. Dass die Partner nicht nur lieben und geliebt werden möchten, sondern ein Recht auf Liebe reklamieren, ist die Quelle der Gewalt in den Beziehungen. Sie reicht von altmodischen Prügeln für die ungehorsame Frau, von weiblicher Revanche durch Beleidigtheit und Psychoterror bis zu extremen Fällen des Rosenkriegs, zum Amoklauf und Gattenmord.
Recht auf und Pflicht zum Sex
Die Liebespflicht bezieht sich heute sogar und sogar vordringlich auf das unmittelbare Gefallen an der anderen Person und an der körperlichen Lust mit ihr. So wird, in den Dienst der Lebensbewältigung gestellt, aus einem Feld des Vergnügens aneinander das Feld des Glücks schlechthin, der entschädigenden Totalbefriedigung, das für beide Geschlechter eine ungeheure Wichtigkeit hat: Der Sex muss klappen, damit der Haussegen nicht schief hängt, an dem immerhin die ganze Reproduktion hängt. Wie todernst das betrieben wird, machen unzählige Eheberater deutlich, wenn sie frustrierten Paaren verraten, wie das geht, was zu tun und zu lassen und eventuell vorzutäuschen ist, damit die Sache gelingt. Es ist eine leicht perverse Kunst, die körperliche Lust, die eine Wertschätzung der anderen Person und eine Vertrautheit schon einschließt, auf eine Art Leistungssport hinzubiegen. Das sexuelle Vergnügen wird auf der einen Seite auf den gekonnten Vollzug des Koitus hingetrimmt, auf der anderen zu etwas viel Wuchtigerem als einem Vergnügen überhöht: zum Fetisch des gelungenen Lebens durch die gelungene Beziehung.
Deshalb ist die sexuelle Befriedigung nicht nur ein anerkanntes Recht der Partner aneinander, sondern eine Aufgabe, an deren Bewältigung sie sich selbst messen. Die eigene Fähigkeit, sexuelles Interesse zu wecken, die eigene Attraktivität steht beständig auf dem Prüfstand. Weil die Partner sich diesen Hauptbeweis von Lebenserfolg und Lebenstüchtigkeit und Lebensglück schuldig sind, gehören Selbstzweifel und Versagensängste ebenso dazu wie das fordernde Auftreten. Desinteresse bzw. Weigerung es Partners sind nicht einfach bedauerlich, sie sind ein Angriff auf den männlichen oder weiblichen Erfolgstypen gegenüber, sie verletzten dessen Selbstachtung und Selbstdefinition, indem sie seine Fähigkeit zur Verführung und seine sexuelle Tüchtigkeit insgesamt in Zweifel ziehen. Frauen wie Männer leiden an dieser Verletzung ihres Stolzes und kämpfen – um ihre Selbstbehauptung auf diesem Feld der Ehre. Wenn ein Mann gewalttätig wird, dann nicht, um sich Liebe oder auch nur sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Es ist die Reflexion auf sich, die Verteidigung des angestrengten Glaubens an sich als zu seinem Erfolg berechtigtes und befähigtes Individuum, als ein in sexuellen Dingen toller Hecht, der sich die Bestätigung dieses Selbstbilds auch gegen den Willen der Frau verschafft. Der Genuss, der daraus erwächst, ist ganz und gar der Selbstgenuss dessen, der sich zu holt, worauf er Anspruch und Recht hat.
Diese gewalttätige Selbstbezüglichkeit lässt ihre Opfer nicht nur unmittelbar leiden, sondern zwingt viele zu Abwägungen von toxischer Trostlosigkeit. Oft genug steht Frauen die Option, den prügelnden bzw. vergewaltigenden Gatten so schnell und so weit wie möglich zu verlassen, nicht sehr frei. Dann, wenn sie als Nicht- oder Wenigverdienerinnen ökonomisch abhängig sind. So wird in aller Schärfe an diesem Punkt der ursprünglichen gemeinsamen Glückssuche noch einmal kenntlich, dass die Gemeinsamkeit objektiv in der Organisation eines Abhängigkeitsverhältnisses zwecks ökonomischer Reproduktion bestanden hat, was sich als Zwangslage entpuppt. Wenn sie nur zwischen Leiden in der Ehe und Armut als Single wählen können, ist es kein Wunder, dass sich bei betroffenen Frauen auch noch der Idealismus zu Wort meldet, dass so schlimm der Mann, unter dem sie leiden, dann doch nicht sei: Dann – so erzählen es zumindest einschlägige Berichte – rechnen sie die „schönen“ gegen die „dunklen Seiten“ des gemeinsamen Glücks auf, auf das sie sich verpflichtet haben; sie fangen an, die Schuld für das Scheitern der Beziehung womöglich bei sich zu suchen, schämen sich für die Gewalt, die ihnen angetan wird, und vertuschen deren Spuren gegenüber der Außenwelt. Experten wissen, dass zu bekannten Zahlen von Gewalt gegen Frauen die vielfach höhere „Dunkelziffer“ gehört.
Diesem Endpunkt, der Selbstbestätigung und Selbstdarstellung als zum diesbezüglichen Erfolg fähiger Typ sind die Geschlechterbeziehungen auch vor und außerhalb der Ehe über weite Strecken untergeordnet. Für viele – nicht nur Männer – ist es eine Art Sport, Exemplare des anderen Geschlechts abzuschleppen, an die sie eben herankommen. Man könnte ja was verpassen. Und für die, denen das nicht oder nicht zureichend gelingt, hält das Gemeinwesen immer noch das legale Institut Bordell bereit, in dem das Geld die Frau entschädigt, gefügig macht. Apropos „rankommen“: Da tun sich gewaltige Unterschiede auf. Die ganze Hierarchie dieser Gesellschaft von Macht und Geld reproduziert sich da. Männer mit Macht – Politiker, Bosse, Filmproduzenten, Chefredakteure, Professoren – können sich auch ohne unmittelbare Gewalt die Gefälligkeiten von Frauen verschaffen; Erfolg macht attraktiv bzw. sorgt das Verhältnis von Chef oder Arbeitgeber und hoffnungsvoller Arbeitnehmerin nicht nur in der Filmbranche für sehr widerwärtige Situationen.
Wo sexuelle Befriedigung zum Recht und der Erfolg dabei zum Prüfstein männlicher Tüchtigkeit wird, gesellt sich zur anerkannten Sitte der doch nicht mehr gebilligte Exzess: Hauptsächlich in Familie und Bekanntenkreis, in extremen Fällen auch gegenüber zufälligen fremden Opfern nehmen sich Männer, was sie als ihr Recht interpretieren. Vergewaltigung ist die extreme Form der Selbstbestätigung des zu seinem sexuellen Erfolg berechtigten und verpflichteten Mannes.
Die Kultur der Übergriffigkeit ist dabei weiter verbreitet als die praktizierten Übergriffe. Männer demonstrieren ihr Selbstbewusstsein als welche, die sich verschaffen können, worauf sie sich qua Geschlecht ein Recht einbilden, wenn sie beliebigen Frauen hinterherpfeifen, sie blöd ansprechen oder angrapschen. Familienväter, die genau wissen, dass sie daheim nicht so reden dürfen, prahlen in der Männerrunde mit den vielen Frauen, die sie hatten oder hätten haben können oder fast gehabt hätten, und präsentieren sich als Genießer – von dem Standpunkt aus, dass Frauen als Angebot speziell für sie zur Verfügung stünden. Der Genuss ist da rein ideell, einer des Selbstbildes, das Männer einander bestätigen. Noch in der lächerlichsten Angeberei bekräftigen sie ihr Recht auf ein erfülltes Sexualleben – und den überragenden, den unglaublich essentiellen Stellenwert, den dieses für die Selbstbestätigung hat – und damit letztlich für die Versöhnung des Individuums mit seiner kapitalistischen Heimat. So haust Mann sich in die Verhältnisse ein.
Die Sitte und die Forderung nach Respekt
Frauen, die sich gegen ihre Rolle in Beruf und Familie und gegen das dazugehörige männliche Rechtsbewusstsein auflehnen, haben mehr gegen sich als nur das schlechte Benehmen von ein paar Idioten, die an angeblich überholten Rollenbildern festhalten. Sie haben es erstens mit einem Arbeitsmarkt und seiner auch am Geschlecht orientierten Sortierung der Arbeitskräfte zu tun. Sie bekommen es zweitens mit der durchaus von beiden Geschlechtern gelebten Sittlichkeit dieser Gesellschaft zu tun, d.h. mit selbstverständlichen und allgemein gebilligten Formen, unter den gegebenen Existenzbedingungen das Leben zu zweit zu organisieren. Natürlich verordnet nicht das Kapital und auch nicht mehr der Staat, wie Mann und Frau zusammenleben müssen und was sie, abgesehen von Geld- und Versorgungsleistungen, voneinander fordern dürfen. Aber Politik und Ökonomie setzen Lebensbedingungen, die beim Zurechtkommen damit regelmäßig in eine eheliche und eheähnliche Gemeinschaft münden – womit die Familie zur nicht nur normalen, sondern normativen Lebensform wird. Und die gerät, weil sie die vorausgesetzte Not an Zeit und Geld und Strapaz nicht ungeschehen machen kann, zu einer verpflichtenden Verzichtsgemeinschaft der Partner mit lauter unbefriedigten Ansprüchen gegeneinander – einschließlich der Exzesse, die zu einem frustrierten Rechtsbewusstsein gehören.
Es verfehlt die Sache, die ökonomischen und familiären Aufgaben der Frau und deren schädliche Wirkungen, das alles als Ausdruck von – im Grunde genommen grundloser – „Frauenfeindlichkeit“, von Frauenhass, „Misogynie“ bzw. allgemein als Folge von mangelndem Respekt zu interpretieren. Dadurch werden all die die gültigen positiven Zwecke, für die Frauen in Beruf und Familie eingespannt sind, samt den negativen Folgen, ziemlich konsequent ausgeblendet, und an Politikern, Kapitalisten, Ehemännern – und sogar am mörderischen Ex – immer nur die fade Eigenschaft festgehalten, dass es sich halt um Männer handelt … So bleibt dann doch ein – verkehrter – Grund übrig, warum Frauen als Niedrigverdienerinnen, Alleinerzieherinnen, Hausfrauen, Sexualobjekte, als Opfer von häuslicher Gewalt und Trennungstötungen wegkommen. Dieser Grund läuft auf das Fehlen einer Bremse beim Umgang mit Frauen hinaus, auf einen Mangel an Respekt.
Nun wird es schon so sein, dass die menschlichen Beziehungen in Demokratie und Kapitalismus allgemein und die zwischen Mann und Frau speziell nicht von einem allseitigen und allgegenwärtigen Respekt getragen sind. Wovon denn dann, das wäre die Frage, worum geht es in Beruf, Beziehung, Familie. Durch die Forderung nach Respekt wird als Ursache weiblicher Probleme eine Freiheit der Männer bestimmt, die beschränkt gehört, durch freiwillige Selbstzucht oder durch die Staatsmacht. Die Rohheit und Gemeinheit, die das Recht auf Glück und speziell auf sexuelle Befriedigung bei Männern hervorbringt, wird damit als selbstverständliche, geradezu naturwüchsige Voraussetzung der Geschlechterbeziehung genommen. Frauen, die vehement der Behauptung widersprechen, die ihnen abverlangten Geschlechterrollen in Beruf und Familie würden ihrer weiblichen Natur entspringen, sie wären also „biologisch determiniert“ – die unterstellen mit ihrer Forderung nach einer Verhaltensbremse genau das beim anderen Geschlecht.