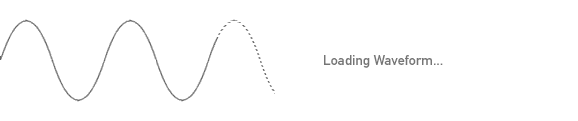Die Familie
Ort des Glücks,
Ort der unbezahlten Arbeit,
Ort des Psychoterrors,
Ort des Amoklaufs
Im „profil“ Nr. 22/2021 schreibt Elfriede Hammerl eine Kolumne mit dem Titel „Ehe leicht gemacht. Man trifft sich, man trennt sich. Schuld, was ist das.“ Es handelt sich um ein – doch etwas überraschendes – Plädoyer für die Ehe als Versorgungseinrichtung speziell für die Frau; und für ein auch lieblose Zusammenbleiben in – wörtlich – „guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet“. Ich bin gefragt worden, was ich davon halte, darum geht es heute; das Thema passt auch zur Familien-Serie.
Die Kolumne bespricht Vorarbeiten im Justizministerium für eine Reform des Eherechts, von Hammerl als „Ehe light“ bezeichnet, wegen ihrer diesbezüglichen Befürchtungen. Das anvisierte Reformwerk beruht auf dem türkis-grünen Regierungsprogramm; da heißt es, es sollen „Regelungen wie Zweck der Ehe, Mitwirkungspflichten, gemeinsames Wohnen, Unterhaltszahlungen, Pensionssplitting und das Verschuldensprinzip überprüft und gegebenenfalls neu gefasst werden, wobei Grundsätze wie Schutz der Kinder, Schutz der schwächeren Partnerin bzw. des schwächeren Partners, Vermeidung verletzender Auseinandersetzungen … im Mittelpunkt der Überlegungen stehen sollen.“ (Regierungsprogramm 2020 – 2024, S. 30)
Die wesentliche Befürchtung von Hammerl gilt einer möglicherweise kommenden „Abschaffung des Verschuldensprinzips“, denn „die Frage des Verschuldens gilt ja im Übrigen als alter Hut. Man trifft sich, man trennt sich. Schuld, was ist das? Was sollen wir uns also unter einer ‘Ehe light’ vorstellen? Unbeschwertes Zusammensein, solange es beiden gefällt, und danach eine heitere Trennung statt einer Bürde von Verpflichtungen, die auch durch Scheidung nicht so einfach loszuwerden ist? Was wäre denn das Gegenteil einer leichtgewichtigen Ehe? ‘… in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet’? Zusammenbleiben, obwohl man einander nicht mehr liebt? Also bitte! Zum Gruseln. Tschüss bei Liebesende, warum nicht?“
Möchte einleitend festhalten, dass mir gegen ein „unbeschwertes Zusammensein, das beiden gefällt“, einfach nichts einfällt. Wenn einer der Beteiligten definitiv nicht mehr will, aber dennoch bleiben muss – sei es auf Basis einer moralischen oder auch materiellen Erpressung –, dann wird sich das auf die Qualität des Zusammenseins nachhaltig auswirken. Frau Hammerl geht davon aus, dass ein „Zusammensein“ häufig auf Mutterschaft und damit auf eine Verquickung der romantischen mit ökonomischen Elementen hinausläuft, die im Falle einer Auflösung ebenso häufig mit dem eindeutigen Schaden für die Frau enden. Der befürchteten „Scheidung light“ unterstellt sie Verschlechterungen zu Lasten des weiblichen Teils, und sieht „gut verdienende Neopatriarchen“ als Nutznießer einer „Ehereform zulasten der Frauen“. Weil in den meisten Fällen die Frauen das Geldverdienen im Interesse der Kinderbetreuung zurückstellen und daher vom geldverdienenden Teil der Partnerschaft zumindest teilweise finanziert werden müssen, so wie das der gesetzliche Unterhaltsanspruch bei aufrechter Ehe vorsieht. Insofern sind Frauen auch nach einer Scheidung auf das Geld verwiesen, das der Gesetzgeber in dieser Situation dem Geldverdiener für die Frau abverlangt – allerdings vermischt das Scheidungsrecht derzeit die Unterhaltspflicht und die Verschuldensfrage. Hammerl befürchtet eine Verschlechterung, indem sie die „Abschaffung des Verschuldensprinzips“ mit einer Aufweichung der Unterhaltsverpflichtungen identifiziert.
„Tschüss bei Liebesende, warum nicht? Blöd ist nur, dass das Entlieben nicht unbedingt synchron abläuft. Das kann unterschiedliche Folgen haben … Derjenige, der nicht mehr liebt, hat ein schlechtes Gewissen und verhält sich bei der Trennung daher wenigstens materiell großzügig. Das wäre anständig, kommt aber eher selten vor, zumal Großzügigkeit einen finanziellen Status erfordert, über den nicht viele verfügen. … Derjenige, der nicht mehr liebt, sieht die andere nur noch als schwer erträgliche Last und will sie so billig wie möglich loswerden. Auch für das Verhalten der oder des nicht mehr Geliebten gibt es zwei gegensätzliche Möglichkeiten. … Die nicht mehr geliebte Person hat ihren Stolz und geht wie das Dirndl vom Tanz. Weshalb sie nachher oft nichts mehr hat als ihren Stolz. Und die Kinder. Und wenig Geld für die Kinder. Die gesetzlichen Regelungen gehen immer mehr davon aus, dass erwachsene Menschen ihr wirtschaftliches Glück selbstständig schmieden können und nicht auf die Tüchtigkeit eines Partners oder einer Partnerin angewiesen sind. … Die nicht mehr geliebte Person will Jahre des loyalen Zusammenwirkens wenigstens finanziell abgegolten haben, vor allem, wenn sie über weite Strecken unbezahlt gewirkt hat, damit der oder die andere mehr Energie in den Gelderwerb stecken konnte. Das wird ihr manchmal als kleinliche Rachsucht ausgelegt. Weil Rachsucht gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, drängt sich der Verdacht auf, dass unter ‘Ehe light’ vor allem eine Scheidung light angedacht wird, bei der jeder und jede sich vom Acker macht wie das schon zitierte Dirndl nach dem Tanz, ohne darüber nachdenken zu müssen, wie die oder der andere künftig über die Runden kommt. Ja, es geht um Geld.“
Eine „Schuld“ sieht Hammerl in dem gezeichneten Bild bei dem Teil, der nicht mehr liebt, weil er nicht mehr liebt, und der darüber ein schlechtes Gewissen haben müsste, für das er zahlen sollte. Das hat, der Genauigkeit halber, mit den „Eheverfehlungen“, die das Eherecht im Verschuldensprinzip bilanziert, nichts zu tun. Fehlende Liebe ist keine Eheverfehlung im Sinne des Gesetzes – es sei denn, der nicht mehr liebende Teil macht Übergänge in Richtung Psychoterror und Gewalt. Fehlende Liebe ist auch sachlich kein Grund für eine Geldzahlung. Das Szenario beruht auch nicht darauf, dass leider das „Entlieben nicht synchron abläuft“, sondern auf materieller Abhängigkeit, und die ändert sich auch nicht, falls beide gleichzeitig nicht mehr wollen.
Aus der verflüchtigten Liebe resultiert jedenfalls die moralische Verpflichtung des voll berufstätigen Teils gegenüber dem nur teilweise oder gar nicht verdienenden Teil. Das wäre zwar „anständig“, aber wie das mit moralischen Verpflichtungen so ist – sie sind im Fall des Falles nicht viel Wert, praktisch relevant ist letztlich die gesetzliche Verpflichtung. Vor allem, weil eine auch von Hammerl wohlwollend konzedierte mögliche „Großzügigkeit“ des Geldverdieners – aus „schlechtem Gewissen“ –, sich daran bricht, dass diese „Großzügigkeit einen finanziellen Status erfordert, über den nicht viele verfügen.“ In der Tat, aber u.U. unangenehm für beide Beteiligte, weil der Geldverdiener dann eben von Staats wegen gleichgültig gegen seinen finanziellen Status zu einer Großzügigkeit verdonnert wird, die sich „nicht viele“ leisten können.
In diesem Szenario kann sich ohnehin nur der verdienende männliche Teil den Trennungswunsch wg. erloschener Liebe überhaupt leisten. Und diese Schuld, also diejenige an der Trennung wegen verflüchtigter Liebe, die interpretiert Hammerl als unverzichtbaren Hebel für die aufs Geld angewiesene Verlassene. Die Möglichkeit, dass die ökonomisch abhängige Frau die Schnauze voll hat und selber weg will, die kommt nicht vor – weil sich der abhängige Teil diese Schuld an einer Trennung wegen dieser Abhängigkeit und in Anbetracht der abschreckenden Perspektive der Alleinerzieherin ohnehin nicht leisten könnte. Die Mütter „verlassen sich auf ihren Mann. Er verdient gut (sic!) und sorgt schon für uns, sagen sie. Er ist nicht so. … Falls er aber doch ‘so’ ist, haben sie wenig Rückhalt vom Gesetz, schon gar nicht, wenn die Ehe noch lighter wird. Dann heißt es: Sorry, gute Frau, wo war ihre Eigenverantwortung?“ Wieder: Die hier unterstellte Variante von Schuld, die der nicht mehr liebende trennungswillige Teil, der sich eine Trennung leisten kann, auf sich lädt, weil er nicht mehr will – und die durch eine Strafzahlung für den Unterhalt der Frau abzugelten wäre – die hat mit den gesetzlichen „Eheverfehlungen“ nichts zu tun. Ironischerweise ist nämlich genau die von Hammerl geforderte Ehe als Versorgungsinstitut die Intention, wenn das „Verschuldensprinzip“ tatsächlich gestrichen werden sollte. Derzeit wirkt sich nach fachfraulicher Stellungnahme das Verschuldensprinzip nicht selten gegen die Frau aus:
Exkurs: Rechtsanwältin Carmen Thornton im Standard 28. 02. 2020: „Das Verschuldensprinzip hat in der Praxis vor allem Auswirkungen auf den Ehegattenunterhalt. Nach aktueller Rechtslage steht dem schlechter verdienenden Ehepartner nach der Scheidung grundsätzlich nur dann Unterhalt zu, wenn die Ehe aus dem alleinigen oder eindeutig überwiegenden Verschulden des anderen geschieden wurde. Ansonsten besteht nur in Ausnahmefällen ein (in der Regel zeitlich befristeter und sehr geringer) Unterhaltsanspruch, insbesondere wenn ein Ehegatte aufgrund der Betreuung eines gemeinsamen Kindes keiner Berufstätigkeit nachgehen kann oder sich nicht selbst erhalten kann, weil er sich während der Ehe um den Haushalt oder die Kindererziehung gekümmert hat. Die Rechtsprechung ist hier aber eher restriktiv, sodass der schlechter verdienende Elternteil letztendlich nur dann finanziell (halbwegs) abgesichert ist, wenn er im Scheidungsverfahren das Verschulden des anderen nachweisen kann. … Das Verschuldensprinzip klingt zwar auf den ersten Blick logisch, denn die Ehe ist ein Vertrag, und ganz allgemein gilt der Grundsatz, dass der vertragsbrüchige Teil dem anderen Schadenersatz leisten muss. In der Praxis führt es allerdings zu höchst unbilligen Ergebnissen. Der Ehepartner, der aufgrund der Kindererziehung und/oder Haushaltsführung beruflich zurückgesteckt hat, steht nach der Scheidung oft mit leeren Händen da, weil den anderen kein eindeutig überwiegendes Verschulden an der Scheidung trifft (oder sich dieses nicht nachweisen lässt). Hinzu kommt, dass die Richterin oder der Richter bei einer strittigen Scheidung feststellen muss, wer die Schuld am Scheitern einer zwischenmenschlichen Beziehung trägt. Das ist in vielen Fällen ein schier unmögliches Unterfangen, das oft zu regelrechten Schmutzkübelkampagnen führt. Außerdem widerspricht das Verschuldensprinzip dem Versorgungsgedanken und damit dem eigentlichen Zweck des Unterhaltsrechts. Der Unterhalt sollte keine ‘Strafzahlung’ sein, sondern demjenigen zustehen, der darauf angewiesen ist. Die Abschaffung des Verschuldensprinzips ist daher sehr zu begrüßen, allerdings muss dann auch das Unterhaltsrecht grundlegend reformiert werden. … Der Unterhalt sollte sich daher nicht am Verschulden, sondern in erster Linie daran orientieren, wie viel jeder für die Ehe aufgegeben hat. Der Ehepartner, der während der Ehe den Haushalt geschupft und sich um die Kinder gekümmert hat, muss auch nach der Scheidung abgesichert sein. Und auch der finanzielle Nachteil von Karenzzeiten oder einer Teilzeitbeschäftigung aufgrund von Kinderbetreuung muss durch einen Ergänzungsunterhalt ausgeglichen werden.“ (Rechtsanwältin Carmen Thornton im Standard 28. 02. 2020) Exkurs Ende.
Wenn das „Verschuldensprinzip“ also tatsächlich gestrichen werden sollte, indem die angedachte Reform auf das bedarfsorientierte Weiterlaufen der ehelichen Unterhaltspflichten abzielt, müssen auf alle Fälle beide nach der Scheidung „über die Runden kommen“, und zwar unabhängig davon, wer sich während der aufrechten Ehe wie gut oder wie schlecht aufgeführt hat. Wer durch „Eheverfehlungen“ im Sinne des Eherechts womöglich zur „Zerrüttung der ehelichen Gemeinschaft“ beigetragen hat, das soll an Relevanz verlieren, wird losgelöst von den bisherigen Unterschieden im Scheidungsrecht, so wie dem „Alleinverschulden“, oder dem „Gleichteiligen Verschulden beider Seiten“, womit bisherige eventuell negative Folgen für den Unterhaltsanspruch wegfallen sollen. (Falls sich etwa die Ehefrau auch mal einen Seitensprung gegönnt haben sollte, der dann vom Göttergatten während des Scheidungsverfahrens gegen sie verwendet wird, was in Folge die Frau richtiggehend zur „Rachsucht“ in der nächsten Runde der „Schlammschlacht“ und zum „dirty campaigning“ zwingt. Nebenbei: Dem absehbaren Hinweis, dass dann womöglich eine notorische Fremdgeherin durch die Scheidung noch belohnt wird, begegnet Thornton so: „Das Argument, dass schwere Eheverfehlungen damit sanktionslos bleiben würden und es ungerecht wäre, wenn ein Ehegatte, der selbst schuld am Scheitern der Ehe ist, vom anderen Unterhalt fordern könnte, ist nicht überzeugend. Schon nach aktueller Rechtslage können besonders schwerwiegende Eheverfehlungen zu einer Verwirkung des Unterhaltsanspruchs führen.“ Standard ebd.)
Die feministische Entdeckung, dass weder die „Ehe schwer“ noch die „light“-Variante das Wohlbefinden von Frauen verbürgt, die wird sich auch in Hinkunft nicht vermeiden lassen, weil es darum nach wie vor nicht geht. Der Gesetzgeber will schließlich nicht für geschiedene Frauen sorgen, er will vor allem sich potenzielle Sozialfälle vom Hals schaffen oder wenigstens reduzieren, indem jedenfalls der Geldverdiener an die Geringverdienerin und die Kinder weiterzahlt, ohne hoffentlich dadurch selber zum Sozialfall zu werden; und das geht auch ohne Schmutzwäsche während des Scheidungsverfahrens. Das wahrhaft Beschädigende an der Ehe ebenso wie der möglicherweise kommenden „Ehe light“ besteht doch darin, dass der Staat den Lebensunterhalt zur Privatsache erklärt und die Beteiligten weiter aneinanderkettet, um dem Staat Kosten und Aufwand zu ersparen: Das bisherige Familieneinkommen, mit dem ein Haushalt so halbwegs und womöglich nur mit einigen Schulden das Auslangen finden musste, das soll nach der Scheidung irgendwie zwei Haushalte tragen – und für den staatlichen Anspruch, dass alle Beteiligten sich gefälligst nach wie vor mit dem bisherigen Einkommen durchwurschteln müssen, ist die Frage nach „Eheverfehlungen“ und „Schuld“ tatsächlich irrelevant!
Nicht die Abschaffung des Verschuldungsprinzips bedroht die „Versorgungsheirat“, sondern mehr das normale, das Durchschnittseinkommen, das so viel Lebensunterhalt häufig gar nicht hergibt. Der Staat erklärt den geldverdienenden Teil zum „Stärkeren“, gleichgültig dagegen, wie „stark“ der Betreffende ökonomisch tatsächlich ist. Dazu kommen die staatlichen Befristungen und Bedingungen für den Unterhalt, sowie die kleinlichen Zumutungen des Arbeitsamtes bei der Jobsuche. Eine Frau, die Kinder großziehen will, macht sich nun einmal von zwei Typen abhängig, von denen einer ganz bestimmt ein mieser Typ ist. Dieser miese Typ, das ist Vater Staat, der zwar ein gesellschaftliches Interesse an der Produktion und Sozialisation des staatsbürgerlichen Nachwuchses geltend macht und ständig die Geburtenrate bilanziert – der die Kosten und die Mühen und die Anstrengungen dafür aber privatisiert hat: Das nennt sich dann „Familie“. (Der Familienbericht 2020 nennt explizit die „Erhöhung der Geburtenrate“ als Ziel der „Familienpolitik“.) „Mutterschaft“ ist de facto ein privatisierter Sozialberuf, teilweise eine Art von 24-Stunden-Pflege. Der zweite Typ, der Kindesvater, wird von Vater Staat auf den Unterhalt verpflichtet, die Kohle hängt also davon ab, wieweit der leibliche Vater im Fall des Falles überhaupt „großzügig“ sein kann, und ob er überhaupt noch „großzügig“ will, nachdem „seine“ Frau und „seine“ Kinder nun fort sind. Diese Lage bietet dann viele Gelegenheiten für die bekannten Gehässigkeiten und Gemeinheiten …
Wenn es schon ums Geld gehen soll, wie Frau Hammerl moniert, dann ist eine gehörige „Eigenverantwortung“ der Frau bei der verantwortungsvollen Partnerwahl unabdingbar: Reich muss „er“ halt sein, und einen hieb- und stichfesten Ehevertrag unterschreiben, sonst wird da nichts draus. Zusammenbleiben auch in „schlechten Zeiten“, das ist nun mal keine Geldquelle und auch kein Ersatz für Geld. Vielmehr gehört zu den vielen Spielarten der „schlechten“ Zeiten auch die Armut, wie in der klassischen Gelöbnisformel – „in Reichtum und Armut“ – ausdrücklich aufgelistet.
Die Familie
Ort des Glücks,
Ort der unbezahlten Arbeit,
Ort des Psychoterrors,
Ort des Amoklaufs
Vor mittlerweile 45 Jahren hat sich eine andere Autorin zu diesen Fragen geäußert, mit einer ziemlich klaren Absage:
„Ich glaube, eine Frau sollte sich vor der Falle der Mutterschaft und der Heirat hüten! Selbst wenn sie gern ein Kind hätte, muss sie sich gut überlegen, unter welchen Umständen sie es aufziehen müsste: Mutterschaft ist heute eine wahre Sklaverei. Väter und Gesellschaft lassen die Frauen mit der Verantwortung für die Kinder ziemlich allein. Die Frauen sind es, die aussetzen, wenn ein Kleinkind da ist. Frauen nehmen Urlaub, wenn das Kind die Masern hat. Frauen müssen hetzen, weil es nicht genug Krippen gibt … Und wenn Frauen trotz alledem ein Kind wollen, sollten sie es bekommen, ohne zu heiraten. Denn die Ehe, das ist die größte Falle.“ (Simone de Beauvoir, Interview mit Alice Schwarzer im SPIEGEL 15/1976)
Was mir persönlich sympathisch ist: Frau de Beauvoir jammert nicht. Sie sagt, so ist es, und formuliert eine Konsequenz. Weiters geht de Beauvoir mit korrekter Selbstverständlichkeit davon aus, dass frau sich entscheiden kann und sich auch entscheidet, so oder anders. Bei Hammerl liest sich das etwas verschwommen, indem die Mütter in einer Rolle „landen“(sic!), die ihnen öfter nicht gut bekommt – ohne eigenes Zutun? Dann müssen sie sich notgedrungen auf den Mann „verlassen“, und dessen fix unterstellte Unzuverlässigkeit möge dann bitte das Gesetz ausbessern …
Als Alternative fragt Hammerl am Ende ihres Textes rhetorisch „was ist eigentlich so gruselig an ‘in guten wie in schlechten Zeiten’?“ Nun, gruselig sind erstens die schlechten Zeiten selbst, „gruselig“ ist schon im Großen und Ganzen dasselbe wie „schlecht“, oder?! Gruselig ist zweitens diese Gleichgültigkeit, das Desinteresse an den „schlechten Zeiten“, auf die es offenbar im Detail nicht ankommt. Als wäre ein auch liebloses Durchhalten und Zähne-zusammenbeißen auf alle Fälle ein adäquates Rezept dagegen. Wenn es einen stehenden Topos in den Erzählungen von Frauen gibt, die es nach einem „jahrelangen Martyrium“ doch noch geschafft haben, sich vom Prügel-Partner zu trennen, dann ist das drittens das gruselige Narrativ, sie hätten es eben (viel zu) lange für ihre Verpflichtung gehalten, als Ehefrau und Mutter im Interesse der Familie auch Opfer bringen und ihre „schlechten Zeiten“ durchzuhalten zu müssen, weil schlechte Zeiten nun mal zur Ehe gehören … Und letztens bekommt besonders die klassische Abschlussformel – „bis dass der Tod uns scheidet“, von Hammerl auch zitiert – schon eine sehr gruselige Konnotation. Angesichts der vergeblichen Versuche der Opfer der letzten viel diskutierten Trennungstötungen, sich den vom Partner verursachten „schlechten Zeiten“ zu entziehen. Wo dann der Partner seinerseits auf diesem glorifizierten bedingungslosen beieinander-bleiben-müssen bestanden hat, bis zum Ende.
Zum Nachlesen: https://www.profil.at/meinung/elfriede-hammerl-ehe-leicht-gemacht/401396298