Die „Political Correctness“,
die „Macht der Sprache“,
und was das mit Rassismus bzw. Antirassismus (nicht) zu tun hat
Der Alltag als günstige Gelegenheit für den Alltagsrassismus
Zur Erinnerung: Am Anfang der Serie zum Rassismus und Antirassismus stand die Absage an die Vorstellung, das sei ein sprachhygienisches Problem, die rassistisch inspirierte Herabsetzung und Verachtung von nach eher unspezifischen Kriterien als nicht zu „uns“ gehörigen Leuten komme im Grunde genommen aus den sprachlichen Mitteln, aus den Formulierungen, in denen sie sich äußert. Und durch die moralische oder gleich rechtliche Unterbindung solcher Ausdrücke könne dem begegnet werden. Damit ist behauptet oder zumindest unterstellt, dass die gegenwärtige Gesellschaft und ihre Ordnung – ganz so, wie das die offizielle, staatstragende Position bei Gelegenheit behauptet – mit Rassismus nichts zu tun hat, nichts zu tun haben kann. Was natürlich die Frage aufwirft, woher das Phänomen kommt, wenn es einfach nicht wegzudiskutieren ist, und dann einem Sündenbock angelastet wird, eben der Sprache.
Meine Gegendarstellung war eingeleitet mit dem Hinweis, dass Rassismus die Menschheit in mehr oder weniger wertvolle bzw. minderwertige Menschensorten einteilt, und dass diese Einteilung, diese Unterscheidung ihren Grund und ihr Material im Unterschied zwischen einem Staatsvolk – oder auch dem Volk schlechthin ohne Beifügung, oder früher mal der Volksgemeinschaft, auf diese terminologischen Unterschiede soll es mal nicht so ankommen – und anderen Leuten hat, die da nicht dazugehören, aber gleichwohl anwesend sind, die in Österreich leben, ob als Minderheit oder als welche mit Migrationshintergrund. Die normale Ausdrucksweise, in der diese Differenz ständig präsent ist, ist das national verstandene „wir“.
„‘Wer ist Wir?’ lautet das Thema eines demnächst stattfindenden Redewettbewerbs für Schüler, bei dem jede Rede halb auf Deutsch und halb in einer anderen Sprache gehalten werden muss. Die darin verborgene Botschaft lautet natürlich: Mehrsprachigkeit ist eine Stärke, keine Schwäche. Und ferner: Menschen, die anderswo geboren sind und eine andere Muttersprache haben, gehören auch zum Wir. Diversität und Vielfalt sind seit Jahrhunderten Teil der österreichischen Identität. Der Wettbewerb wird von einer NGO organisiert. Die offizielle Linie in Österreich sieht freilich anders aus. ‘Wir’ sind die Einheimischen, und wer dazugehören will, muss einen kaum zu bewältigenden Spießrutenlauf hinter sich bringen, an dessen Ende – vielleicht, vielleicht aber auch nicht – ein österreichischer Pass stehen könnte.“ (Der Standard 28.10.2021)
Das „wir“, um das es hier geht, ist also umstritten und manchmal unscharf abgegrenzt – aber in dem Kommentar kommt noch eine ziemlich realitätsnahe Sicht zum Ausdruck: Es geht um die österreichische Identität, und nicht um irgendeine Gruppe, die sich für einen gemeinsamen Zweck findet. Es hat etwas mit Staatsbürgerschaft zu tun, und in dem Status findet ein diesbezügliches Bedürfnis ein Ende, seine Erfüllung. Das Individuum ist damit vollberechtigter Staatsbürger, was Anwürfe im Alltag übrigens nicht ausschließt. Andere Darstellungen sind da etwas radikaler. In einem kritischen Buch über „Populismus für Anfänger“ wird das „Wir“ gleich als Erfindung abgetan, weil es sich eben um eine von „oben“, vom Staat gesetzte Veranstaltung handelt:
„Erfinden sie eine Gesellschaft, die nur aus zwei Gruppen besteht: den WIR und den ANDEREN. … Die wichtigste Bezeichnung für die WIR ist ‘das Volk’. … Wer ist aber ‘das Volk’? ‘Das Volk’ – und das ist der zentrale Punkt – gibt es gar nicht. Es ist schlichtweg eine Erfindung. … ‘Das Volk’ und die WIR … sind aber eine reine Erfindung, ein Märchen, eine Fiktion. Die WIR sind idealisierte Menschen, die nirgendwo anzutreffen sind. Sie sind nur ‘brav’, ‘arbeitsam’, ‘bürgerlich’, ‘modern’, ‘tüchtig’ und so fort. Innerhalb dieser WIR-Gruppe gibt es keine Konflikte, keine Spannungen, keine Probleme. Es ist die erfundene heile Welt einer frei erfundenen Gruppe.“ (Walter Ötsch / Nina Horaczek: Populismus für Anfänger, Frankfurt am Main 2017 S. 13 ff.)
Nun ja. Das (moderne, das heutige) Volk gibt es schon, indem es den Staat gibt. Das Volk ist die Gesamtheit der Bürger, die ein Staat zu den seinen zählt, und deswegen mit den Grund- oder Bürgerrechten ausstattet. Und eine Idealisierung – des Volkes, z.B. – ist schon etwas anderes als eine Erfindung, als ein Produkt der reinen Phantasie. Wenn da Leute schon idealisiert werden – ‘brav’, ‘arbeitsam’, ‘bürgerlich’, ‘modern’, ‘tüchtig’ – dann sind diese Attribute doch als Ansprüche kenntlich, als Forderungen, die demokratisch gewählte Politiker an ihre lieben Österreicher stellen, auch wenn diese Ansprüche gleich als Komplimente daherkommen. Und für diese Ansprüche werden sie vereinnahmt, indem sie als das „Wir“ tituliert werden. Solche Forderungen wie „arbeitsam“ und „tüchtig“ und bei Gelegenheit auch „anständig“, die bleiben ohnehin nicht dem guten Willen oder den Launen der Betroffenen überlassen.
Dafür sorgt die hoheitliche Gewalt, die die österreichische Lebenswelt prägt und definiert: Man muss sich im Ausbildungswesen bewähren, indem man zusätzlich zu dem, was man da lernt, auch noch besser und schneller lernt als die lieben Mitschüler bzw. Konkurrenten; anschließend muss man sich am Arbeitsmarkt behaupten bzw. es wenigstens versuchen, wo man ebenfalls mit anderen verglichen wird, die auch Geld brauchen; und mit den Resultaten in Sachen Einkommen muss man dann schauen, wie weit man (als Frau oder Mann) am Markt für Konsumgüter und am Wohnungsmarkt kommt. Zwischendurch ist Mann auch noch mit der Erfüllung einer Wehrpflicht oder eines Wehrersatzdienstes befasst.
Das alles ist alternativlos, dafür sorgen die Eigentumsordnung und die jeweiligen Märkte sowie die staatlichen Veranstaltungen wie eben Ausbildung und Ehe und Sozialversicherung und Bundesheer. Die Redeweise davon, dass „das Leben ein Kampf“ sei, die spielt auf die einschlägigen Erfahrungen im Alltagsleben an, in dem die eigenen Bemühungen um Ausbildung, um ein Einkommen, um eine Wohnung und sogar um eine Beziehung oft von übergeordneten Instanzen oder Konkurrenten, die den eigenen Interessen im Wege stehen, konterkariert werden. Da erfährt man in der Regel neben einigen Erfolgen auch viele Niederlagen und Misserfolge. Man ist mit seinen Bemühungen eben in ein fix vorausgesetztes System der Geldvermehrung eingespannt, das jedem individuellen „Streben nach Glück“ den verbindlichen Rahmen vorgibt. Das heißt für den großen Teil der Gesellschaftsmitglieder, dass sie, um für sich Geld zu verdienen, sich mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen als brauchbar für eine Firma, einen Betrieb erweisen müssen, also sich im Dienst an fremdem Reichtum bewähren müssen, in der Regel mit viel Einsatz, mit Beflissenheit und Bescheidenheit bei der Entlohnung, was die Politik dann öfter lobend erwähnt. Diesen äußeren Ansprüchen ist zu genügen, der unvermeidliche Ärger mit Vorgesetzten und Kollegen ist auszuhalten.
Man kann nun die Ungemütlichkeiten einer kapitalistischen Erwerbsgesellschaft samt Familienleben auf konstruktive Art und Weis deuten und interpretieren. Man kann aus der eigenen Anpassung an die erwähnten Einrichtungen, aus dem aufgenötigten Mitmachen, zu dem praktisch keine Alternativen vorgesehen sind, eine Gewohnheit machen, eine Selbstverständlichkeit, weil es halt nun einmal so ist, wie es ist. Man kann die äußeren Umstände gleich noch als Normalität interpretieren, in die man halt eingespannt ist – und die eigenen Bemühungen, für eindeutig normal halten. Man kann diese banale Normalität auch als das deuten, was sie ist, nämlich glatt als die hiesige Norm, als ein Imperativ, dem man selbst und alle anderen zu folgen haben. Nicht nur, weil es eben so ist, sondern vor allem, weil sich das auch so gehört, als das Befolgen eines nicht nur vorgeschriebenen, sondern auch anständigen, ehrenwerten Kanons – dessen Zwangscharakter man durch Gewöhnung längst zur Selbstverständlichkeit veredelt hat, ohne ihn zu leugnen. Denn im verbreiteten Stolz auf die Erfüllung von vorgegebenen Pflichten kommt durchaus zum Ausdruck, dass da Leute sehr fremdbestimmt agieren. Dieses eigene Mitmachen kann man eben auch als praktizierte Moral deuten, nicht bloß als erzwungene Anpassung – sondern eben als gelebten Anstand, vor allem dort, wo die Anpassung auf Verzicht, Zurückstecken und Resignation hinauslausläuft.
Wenn man alle diese Verwechslungen und Übergänge – Mitmachen, Anpassung, Gewohnheit, Selbstverständlichkeit, Unterwerfung, Normalität, Norm, Pflicht, Anstand und Sitte – hinter sich hat; wenn man alle diese Interpretationen und Stellungen zu den vorausgesetzten Verhältnissen in jeder beliebigen Richtung und in jeder Reihenfolge verwechselt, wenn man gefühlsmäßig alle miteinander in eins setzt, dann ist man angekommen in dem, was „Heimat“ ist. Heimat ist nämlich keine Gegend, sondern wirklich ein Gefühl, das einen die missbräuchliche Verwendung eines Possessivpronomens erleben lässt: Heimat besteht darin, dass man alles Mögliche und Disparate, was einem garantiert nicht gehört und nie gehören wird, sehr ideell und quasi-eigentumsmäßig, als „mein“ oder „unser“ interpretiert. Der Heimatbewusste schließt von seiner gewohnheitsmäßigen Anpassung an die hiesigen Umstände sehr kühn darauf, dass die furchtbar gut zu ihm passen, also mehr oder weniger extra für ihn und seine Selbstverwirklichung gemacht sind, also in dem Sinn ganz fundamental die „seinen“ sind. In dieser leicht verfremdeten Form akzeptieren viele Leute die – sachlich und nüchtern gesehen – Unterwerfung unter die von der hiesigen Obrigkeit erlassenen politischen und ökonomischen Richtlinien und deuten sie in Umkehrung des tatsächlichen Verhältnisses als genuine Verwirklichung ihres Willens, ihrer Bedürfnisse. Letztlich als Realisierung ihrer „Identität“. Wer sich auf diese Weise mit den Verhältnissen „identifiziert“, in denen er steckt, der definiert dann auch seine Identität durch die die Verhältnisse, in denen er drinnen steckt, und will unter Umständen ein Recht, sein Recht auf seine Umgebung daraus ableiten: Darauf, dass die Lebensumstände so sind und bleiben, wie sie sind, weil er drinnen steckt und daher ein quasi natürliches Recht auf seine Umgebung hat, weil sie doch die seine ist, weil sie für ihn gemacht ist. Kann man übrigens momentan an den Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie beobachten: Sachlich werden bloß ein paar obrigkeitliche Erlaubnisse und Beschränkungen modifiziert – aber es gibt offenbar Leute, die die vorherigen Erlaubnisse und Beschränkungen für so etwas wie ihren persönlichen Besitz halten, und sich auf dem Weg in die Diktatur wähnen. (Wäre ein anderes Thema.)
Woraus (für Heimatbewusste) schlagend klar wird, dass diejenigen, die nicht schon immer hier und auf diese Weise „verwurzelt“ sind, dass die eben nicht hierhergehören bzw. mindestens ein Problem sind. Sie können diese Stellung zum hiesigen Gemeinwesen im Grunde genommen gar nicht hinkriegen, weil sie das nicht von klein auf verinnerlicht haben. In den Sitten und Gebräuchen ist ein umfangreiches Vorschriftenwesen und die dauernde Anpassung enthalten, eine ordnende übergeordnete Gewalt und die je eigene Unterordnung gehört dazu – das wird zwar ohne allzu viele Details, aber in allgemeiner Form durchaus mitgedacht und mitgemeint. Viel wichtiger ist aber Leuten, die sich auf diese Weise als ein Volk verstehen, die idealisierte Lesart dieses Verhältnisses: Weil sich alle an das halten (müssen), was hier gilt, soll es sich jenseits dessen, woran sich alle halten müssen, um eine ganz eigene Gemeinschaft mit einem ganz eigenen wertvollen Sittenkodex handeln, der also „uns“ auszeichnet und „uns“ darüber zu einem ganz eigenen Menschenschlag macht. Diese idealisierte Vorstellung von der nationalen Gemeinschaft, die existiert vor allem in der Selbstverständlichkeit, mit der alle Welt den Plural „wir“ verwendet, wenn vom „eigenen Staat“, wenn von der Republik Österreich die Rede ist; das machen durchaus auch Leute, die einem „Heimatbegriff“ womöglich skeptisch gegenüberstehen. Das normale, gewöhnliche, unspektakuläre „wir“ transportiert das Bild von der Community, die „wir“ sind oder wenigstens sein könnten oder sollten, und in der alle gut bedient wären und auf ihre Kosten kämen – wenn sich alle an das halten würden, was sich gehört. Dann wäre die Welt in Ordnung – und das ist nicht so weit weg von der rechtsradikalen Position, dass das „eigene Volk“ eigentlich harmonisch, konfliktfrei und ohne größere Kriminalität unterwegs wäre.
Mit dem „Heimatgefühl“ steht der wesentliche Befund über Fremde, Ausländer und Flüchtlinge fest – und zwar ziemlich gleichgültig bezüglich dessen, was die tatsächlich in Europa machen oder nicht: Die haben sich eben nicht von klein auf den hiesigen Sitten unterworfen, die sind also nicht so angepasst worden wie „wir“ – sie sind also nicht so wie „wir“, haben unsere Sitte und unseren Anstand nicht so verinnerlicht wie „wir“, sind also in keiner Weise verlässlich wie „wir“, also verdächtig und in dem Sinn womöglich ein Anschlag auf die hiesige Moral bzw. zumindest ein Problem. Leute, die nicht schon immer „dazugehören“ – woran auch immer der autochthone Wurzelösterreicher das entdeckt –, die stehen im Verdacht, nicht fähig und/oder nicht willens zu sein, sich an das zu halten, was sich hierzulande gehört. Wer die Deduktion von Unterwerfung und Anpassung bis zum eigenen Anstand hinkriegt, der schafft auch die gegenläufigen Folgerungen von „fremd“ ist gleich „anders“, ist gleich „abweichend von der Norm“, ist gleich ein „Verstoß“ gegen die guten Sitten, also womöglich ein Angriff auf diese. Der Verdacht sucht und findet dann seine Belege. Vor allem darin, dass die Fremden doch aus eigenem Antrieb, aus ihrem Interesse an einem besseren Leben, also aus Egoismus kommen.
Fremde Gebräuche – es sei mal dahingestellt, ob Einwanderer wirklich so anders leben wie Einheimische in den entsprechenden Etagen von arm und reich – werden von den Hardcore-Heimattreuen nicht als auch eine Variante der Lebensbewältigung gleichgültig bemerkt, als ein Teil des Pluralismus der Lebensstile und Subkulturen, sondern als Infragestellung, als Verstoß gegen die eigene Lebensart beurteilt, als Verweigerung des Konformismus, der „uns“ zu einer Gemeinschaft macht, als Parallelgesellschaft. Spätestens an den Ansprüchen gegenüber Fremden auf „Integration“ wird über die einheimischen Sitten noch einmal eines deutlich: Sie haben den Zwangscharakter von Pflichten, den Charakter einer Unterordnung – und das bringen die Fremden möglicherweise nicht, weil sie zwar genau solche determinierten, geprägten Abziehbilder der Verhältnisse sind, aber eben ursprünglich anderer, auswärtiger Verhältnisse.
Allerdings täuschen sich die Fanatiker der Heimat, so sehr sie auch ideologisch hofiert werden, doch in ihrem Gemeinwesen und dessen Prioritäten. Da mag von Seiten der Politik der Unterschied zwischen „uns“ und den anderen bei jeder Gelegenheit betont und hervorgehoben werden – im Alltag sind die Migranten in einer sehr wesentlichen Hinsicht gleichgestellt: sie sind genauso brauchbar und sie werden auch gebraucht für das ökonomische Wachstum, auf das es über alle Phasen von Konjunktur und Krise hinweg ankommt. Deswegen werden sie nicht weniger, und Bevölkerungspolitiker rechnen sogar einen ständigen Bedarf nach menschlichem Zustrom hoch, aus den Geburtenraten und der nationalen Alterspyramide. Manche Eiferer des wahren Österreichertums belassen es angesichts dessen nicht beim Wählen der FPÖ, sondern werden eigeninitiativ. Gelegenheiten dazu haben sie.
Denn im Alltag des Klassenstaates und seiner staatlichen Verwaltung blamiert sich permanent das Ideal von der freiheitlichen und gleichheitlichen und solidarischen Gemeinschaft, das im „wir“ ausgedrückt ist. Die hiesige Ordnung ist ein Sammelsurium von Über- und Unterordnungsverhältnissen, von Weisungsbefugnissen und Pflichten, von Abhängigkeiten und Konkurrenzverhältnissen samt den entsprechenden unangenehmen Verhaltensweisen in den praktischen Verlaufsformen von Unfreiheit und Ungleichheit. Bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern handelt es sich um ein wechselseitiges Benutzungsverhältnis – diese wollen Geld, jene wollen Leistung –; da ist klar, wer am längeren Hebel hantiert, erst recht, solange es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt. Sobald es das nicht gibt, erhört die Politik den Ruf der Wirtschaft und debattiert sofort über Zumutungen für Arbeitslose und / oder zusätzliche Kontingente auswärtiger Arbeitskräfte. Was heißt da „wir“? Im Ausbildungswesen gehört es sich zwar nicht, die Lehrenden als Vorgesetzte zu titulieren, aber dass es sich bei denen um die Instanzen handelt, die Forderungen an ihre Zöglinge stellen und diese beurteilen, darüber täuscht sich auch niemand. Was heißt da „wir“? Dass die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft am Wohnbedürfnis der Leute verdienen darf und soll, ist klar, weswegen die Klagen über unerschwinglichen Wohnraum ein Dauerthema sind. Was heißt da „wir“? Dass es, wenn die kalte Jahreszeit kommt, spätestens um Weihnachten die üblichen und gar nicht außergewöhnlichen Berichte zu bestaunen gibt, die von einer sehr unangenehmen Alternative für etliche Haushalte berichten – entweder warme Wohnung oder anständiges Essen –, das ist normal und gewohnt. Was heißt da „wir“? Dass viele Betroffene so ihre Erfahrungen mit der Sozialbürokratie und der Verwaltung im Allgemeinen machen, und öfter abschlägig beschieden werden, gehört zum Way of life – was heißt da „wir“?
Diese Erinnerung an die Sitten und Gebräuche der Leitkultur soll deutlich machen, dass beim sogenannten „Alltagsrassismus“ nichts groß neu erfunden wird in Sachen Schikane und Gemeinheit. Ob man eine Wohnung nicht kriegt; oder wegen des „falschen“ Vornamens oder eines Kopftuches gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird; ob in einem Amt wem geholfen wird, der oder die sich nicht so gut auskennt – oder ob das gegen diese Person verwendet wird und man sie auflaufen lässt; ob ein wohlmeinender Lehrer vom Besuch der höheren Schule abrät – natürlich im Interesse eines Schülers, der sich ev. schwer tun würde; ob ein Bürgermeister einen Hauskauf verhindern will, weil er findet, Muslime passen nicht in seine Gemeinde; ob ein Restaurant oder eine Disko die Gäste selektiert, weil es auf ein gewisses Publikum mehr Wert legt als auf anderes; ob Ordnungskräfte bei fremd wirkenden Leuten ganz genau hinsehen – das sind alles etablierte Kompetenzen, Befugnisse, Spielräume oder wenigstens Grauzonen. Sicher, das Beschimpfen einer Kopftuchträgerin in der U-Bahn gehört sich eindeutig nicht, was auch kein Hindernis dafür sein muss – aber alle rechtlichen Diskriminierungsverbote geben eher darüber Auskunft, was da alles zum Alltag gehört und nicht endet.
Dem setzen antirassistische Initiativen ihre Vorstellungen von Gleichheit und Menschenrecht entgegen, und damit soll es beim nächsten Mal weitergehen.
Lesetipp: Einmal Rassismus allgemein, dann anlässlich eines der letzten Toten in den USA.
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/rassismus
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/vom-rassismus-einer-freiheitlichen-egalitaeren-staatsgewalt




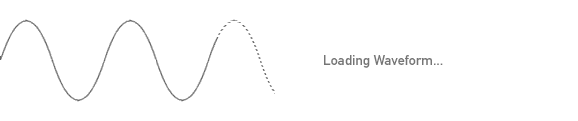






im bermuda.funk in sonar am 2.11..
Vielen Dank!