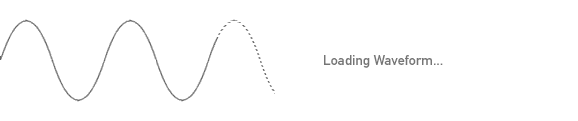Rassismus und Antirassismus: Worüber reden wir eigentlich?!
Im Zuge der Reihe über „Rassismus und Antirassismus“ haben mich einige Einwände erreicht, die m.E. darauf hindeuten, dass zumindest ich an einigen Zuhörern und Lesern vorbeirede, entlang der Frage, was ist denn „Rassismus“, im Grunde genommen. Ich habe im Zuge der früheren Beiträge mal eine Definition vorgelegt, möchte jetzt aber einen anderen Zugang probieren. Ich bin nämlich auf eine Broschüre aufmerksam gemacht worden, die trägt den wuchtigen Titel „Sprache schafft Wirklichkeit“ – es geht also um das von Anfang an umstrittene Thema „Macht der Sprache“. Die Broschüre versteht sich als Anleitung für einen „rassismuskritischen Sprachgebrauch“ in Gestalt eines „Glossar“ und einer „Checkliste“. Will also etwas probieren und so überlegen: „Wenn das Rassismuskritik ist, was ist denn dann Rassismus?“
Dieses Glossar bietet „schnelle Alternativen für rassistische und diskriminierende Wörter“ an, also korrekte im Unterschied zu fragwürdigen Bezeichnungen. Die Stichworte lassen sich grob einteilen in welche, die das Verhältnis des Staates zu Inländern bzw. zu Ausländern und Zuwanderern betreffen, damit möchte ich beginnen – zum anderen geht es um das Verhältnis der Staaten untereinander, Bezeichnungen wie „Dritte Welt“ oder „Entwicklungshilfe“ sollte man vermeiden. Die Broschüre stammt von einem „Antidiskriminierungsbüro Köln“, ein link dazu findet sich wie üblich in der Mitschrift dieser Sendung auf cba.media – Podcast „Kein Kommentar“. (https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/download/antirassistische-sprache.pdf)
Die praktische Sortierung der Menschheit
Los geht es mit einer Erinnerung an das richtige Leben. Bekanntlich ist der Globus heutzutage lückenlos in verschiedene Staatsgebiete aufgeteilt, jeder m² steht unter einer politischen Herrschaft, auch wenn es ab und an unterschiedliche Ansprüche auf dieselben Gegenden gibt. Diese Aufteilung schließt eine Sortierung der Menschen ein; auch die Leute sind „ihren“ politischen Gewalten zugeordnet und als Staatsbürger von diesen anerkannt und mit Rechten ausgestattet, mit staatlich anerkannten Erlaubnissen – auch da sind manche Zuordnungen umstritten. Auf Basis dieser Zuordnung der Leute zum Land, der Völker zu den abgegrenzten und politisch regierten Räumen entfaltet sich schon länger ein reger grenzüberschreitender Verkehr, der unter einer entscheidenden Prämisse steht: Wer wo hinein darf oder nicht, wer wo wie lang und unter welchen Umständen bleiben darf oder nicht, das unterliegt dem Beschluss der regierenden höchsten Gewalt. Man wurde ja durch die Pandemiebekämpfung wieder nachdrücklich daran erinnert, dass zur Grenze eben die Kontrollen gehören, die in Europa zeitweilig zurückgefahren wurden, im Zuge des EU-Binnenmarktes. Auf der Grundlage des staatlichen Interesses oder Desinteresses an Ausländern existiert eine differenzierte Hierarchie von Privilegierungen und Diskriminierungen, von sehr unterschiedlichen Berechtigungen verschiedener Leute je nach Herkunft und Funktion. Das beginnt schon mit der Frage des Visums oder Sichtvermerks, das ist eine vorab geprüfte, auf das Individuum bezogene Erlaubnis zur Einreise oder Durchreise oder Ausreise, je nachdem. Manche Staaten verzichten gegenüber anderen Staaten bzw. gegenüber deren Bürgern auch auf die Pflicht zum Visum. Aber im Prinzip geht es damit los.
Diplomaten etwa sind gegenüber einheimischen Bürgern privilegiert, sie genießen nämlich „Immunität“ – nicht gegenüber einem Virus, sondern gegenüber der Strafverfolgung im Land, in dem sie stationiert sind. Das soll nämlich sie bzw. ihren Staat vor Repressalien des Gastlandes schützen, darauf haben sich die Staaten geeinigt.
Touristen sollen in der Regel nach Österreich einreisen, teilweise auch ohne Visum; je nach Heimatland. Der Tourist darf aber nur befristet bleiben, er darf nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, er muss vielmehr über genügend Mittel verfügen, um seinen Aufenthalt zu finanzieren und Österreich wieder zu verlassen – er soll ja Geld mitbringen und hier lassen. Er ist natürlich auch nicht wahlberechtigt, er darf auf Basis dieses Touristen-Status auch keine Ansprüche an den Sozialstaat stellen, es sei denn da gibt es zwischenstaatlich Abmachungen. Unternehmerische Aktivitäten fallen wieder unter einschlägige Bestimmungen. Kontrolliert werden seine Finanzen nicht generell, gegenüber den Angehörigen bestimmter Staaten über das Visum aber schon. [Die Einzelheiten erfährt man im Außenministerium.]
Gastarbeiter wurden früher mal extra eingeladen, weil sich die damalige Vollbeschäftigung als Albtraum des Wirtschaftswachstums entpuppte: Es gab schlicht zu wenig Arbeitskräfte. Diese sog. Gastarbeiter wurden diskriminiert, sie brauchten in Österreich etwas, was der Eingeborene nicht braucht, nämlich eine Beschäftigungsbewilligung des AMS, die dem Betrieb erteilt wurde und die den Gastarbeiter einige Jahre an diesen gebunden hat. Diese Bewilligung ist auch heute notwendig, allerdings für Interessenten außerhalb der EU, denn innerhalb des Binnenmarktes gilt die Personenfreizügigkeit, d.h. EU-Bürger dürfen innerhalb der EU wohnen und arbeiten, was sich für viele Leute durch den „Brexit“ wieder geändert hat.
Asylwerber bzw. Flüchtlinge sind erwünscht oder auch nicht. Wie erinnerlich war eine weißrussische Leitathletin, die sich während der olympischen Spiele in Tokio mit der Mannschaftsführung zerstritten hatte, voriges Jahr heiß begehrt. Ihr wurde das sog. „Asyl-Shopping“ angeboten, sie konnte es sich aussuchen, sie hat aber Österreich die kalte Schulter gezeigt und Polen gewählt; man war hier enttäuscht. Chinesen aus Hongkong sind momentan begehrt, in Großbritannien zumindest, dort kriegen sie von Boris einen britischen Pass zweiter Klasse, aber immerhin. Gemessen an den Ansprüchen, die diese beiden Beispiele verdeutlichen, ist die große Masse der Flüchtlinge vor allem aus Afrika völlig unbrauchbar. Sie taugen nicht zur Feindbildpflege. Sie klagen ja höchstens jene Zustände an, für die die Weltwirtschaftsordnung und die „Globalisierung“ des Kapitals verantwortlich sind. Sicher, das Asylinteresse kann sich ändern, falls sich ein Kandidat für einen politischen „Regimewechsel“ irgendwo bemerkbar macht. Die Anfeindung des Taliban-Regimes kommt inzwischen jedoch völlig ohne menschliches Beweismaterial aus, der Afghane notiert an der Flüchtlingsbörse aktuell als eine Art „Junk-Bond“, ist wertlos, zumindest in Österreich.
Migranten – frühere Gastarbeiter oder Flüchtlinge, die zu Einwanderern wurden –, sind Leute, die eines geschafft haben: Sie haben den Schritt von vielen befristeten, bedingten, beschränkten und ständig gefährdeten Aufenthaltsbewilligungen zum Staatsbürger vollziehen können – je nach den Bedingungen, die „ihr“ neuer Staat dafür vorsieht. Ihr früherer Status klebt dennoch an ihnen, nicht nur in der Sozialstatistik: Sie sind welche mit „Migrationshintergrund“ und dürfen sich im politischen Diskurs öfter fragen lassen, ob sie wirklich schon mit Haut und Haaren und mit Geist und Gemüt in der neue Heimat angekommen sind.
Illegale sind quasi deren Gegenpol. Das sind auswärtige Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung, also Leute, die im jeweiligen Land von Rechts wegen nicht existenz-berechtigt sind, an denen der Staat kein positives Interesse hat, von denen er nichts will, die von Staats wegen politisch, ökonomisch und auch moralisch unbrauchbar sind. Der Genauigkeit halber gehören zu den Unbrauchbaren auch die zig-tausend Toten im „Friedhof Mittelmeer“ (der Franziskus in Rom). Die passende Bezeichnung „lebensunwertes Leben“ hat sich noch nicht durchgesetzt.
Nicht die Sprache, sondern die jeweilige Staatsmacht erzeugt diese verschiedenen „Wirklichkeiten“ von Inländern und Ausländern, und dann innerhalb der Ausländer; eine ziemlich „bunte“ Landschaft abgestufter Berechtigungen und Diskriminierungen. Diese ausdifferenzierten Sortierungen – vom vollberechtigten Staatsbürger bis zum „Illegalen“ mit allen Statuszuweisungen dazwischen –, die haben nach dem selbstgefälligen, selbstgerechten demokratischen Selbstbewusstsein mit „Rassismus“ nichts zu tun; weil alle diese Privilegierungen und Diskriminierungen sachlich begründet sind, weil sie im nationalen Interesse liegen und obendrein demokratisch-rechtsstaatlich abgewickelt werden.
Die wunderbare Welt der Rassismuskritik
Damit befasst sich auch der erwähnte „Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch“. [Das Glossar mit Empfehlungen für den Sprachgebrauch ist übrigens durchgehend gegendert. Ich spare mir das, es tut der Verständlichkeit keinen Abbruch.] Er beanstandet Bezeichnungen wie „Ausländer_in mit deutschem Pass“ – statt einfach „Deutsche_r“ – als „diskriminierend“, ebenso wie die Bezeichnung „Passdeutsche_r“, weil „abwertend“, was ja stimmt. Jetzt kommt es allerdings schwer darauf an, wie man weitermacht. Entweder stellt man sich auf den Glossar-Standpunkt, so etwas gehöre sich einfach nicht, und wenn solche Abwertungen dennoch täglich vorkommen, dann gehören wenigstens die sprachlichen Bezeichnungen untersagt oder geächtet. Oder man nimmt zur Kenntnis, dass es offenbar das Bedürfnis gibt, zwischen Inländern erster und zweiter Klasse (Passdeutscher, Ausländer mit deutschem Pass) zu unterscheiden, und stellt die naheliegende Frage, womit man es da zu tun hat? Woher kommt das? Was kann man dem entnehmen?
Nun, noch jeder Staat behauptet von sich, mehr zu sein als bloß die Obrigkeit über die Untertanen bzw. die Bürger, mehr und Höheres als bloß ein Gewaltmonopol mit Anspruch auf ein eigenes, ihm zugeordnetes und nützliches Kollektiv. Der Staat sei vielmehr der Sachwalter eines ganz eigenen Menschenschlags, der sich durch ganz eigene Eigenheiten oder Eigenschaften von anderen unterscheidet und auszeichnet; durch eine ganz eigene „Identität“. Gängige Bilder für diese nationalen Eigenheiten sind die Sprache, die Kultur, die Tradition, die Religion etc. usw., früher auch die Abstammung. Auf die Plausibilität und die Genauigkeit dieser Bilder kommt es nicht übermäßig an, aber dass es nationale Besonderheiten geben muss, das steht fest; und darauf beruft sich die Unterscheidung zwischen den „echten“ und den bloßen Pass-Deutschen.
Die Geschichte vom nationalen Kollektiv als einer unpolitischen und vor-politisch existierenden Community, die sich einen Staat gibt, der ihre kollektiven Belange organisiert, wenn er sie beherrscht – die gehört zu den Narrativen jeder Nation, die sich damit selber ihre höhere Notwendigkeit bescheinigt. Das ist identisch mit der Auffassung, „deutsch“ oder „österreichisch“ zu sein, das sei weit mehr als die bloß äußerliche Zugehörigkeit zu einem äußeren Gewaltmonopol, wie sie sich im Pass dokumentiert. Es handle sich vielmehr um eine individuelle Eigenschaft, um die entscheidende „Identität“ geradezu, die einen Menschen innerlich wesensmäßig prägt und auszeichnet – und damit sei eine quasi natürliche Bindung an die organisierende Obrigkeit gegeben, die eine unerschütterliche Zuverlässigkeit und Parteinahme für „seine“ Nation bedinge. Wo sich der Migrant für seinen neuen Pass entschieden hat, in der Regel, damit es ihm besser gehe, was auch gern als Egoismus denunziert werden kann – da ist eben zum „Passdeutschen“ das Gegenbild des „echten“ Deutschen unterstellt; eines Deutschen, der sich nie für und schon gar nicht gegen „seine“ Nation entscheiden wollte und konnte, sondern sie als determinierende Bestimmung, vielleicht als sein vorgegebenes Schicksal, jedenfalls fraglos angenommen hat. Der Migrant wieder konnte, durch seine Herkunft von außerhalb, den neuen nationalen way of life gar nicht so radikal verinnerlicht haben, er konnte sich nicht so damit vollgesogen haben wie der Bio-Deutsche oder der Wurzel-Österreicher, er konnte die Bindung an die Nation, die den Patrioten auszeichnet, gar nicht so unabweisbar entwickeln und ausbilden.
An diese gängigen Vorstellungen von Nation streift der rassismuskritische Leitfaden ein klein wenig an, und er quittiert diese Essentials moderner Staatlichkeit mit radikalem Desinteresse. Denn wenigstens die Migranten, die es bis zur neuen Staatsbürgerschaft geschafft haben, wo also staatsrechtlich wirklich alles in Ordnung ist, die sollten sprachlich in Ruhe gelassen und nicht mit abwertenden Bezeichnungen bedacht werden.
Statt des Wortes „Einheimische_r“ „als Bezeichnung für Deutsche ohne Migrationshintergrund“, wird als Alternative „weiße Deutsche, Biografisch-Deutsche (Biodeutsche), Deutsche ohne Migrationshintergrund“ oder „Herkunftsdeutsche“ empfohlen. Denn „Einheimischer“ für einen „Deutschen ohne Migrationshintergrund“ unterschlägt, dass „viele Eingewanderte und ihre Kinder einheimisch sind,“ so dass durch „Einheimischer“ eine unerwünschte „Assoziation“ des „fremdländischen Migrant_innen“ entstehen könne.
Da wird es skurril, denn die gebilligte Bezeichnung „Migrationshintergrund“ ist identisch mit dem Befund des „fremdländischen Migranten“, nachdem Eingewanderte nun mal aus einem fremden Land kommen. Ausgerechnet das moderne Stigma vom „Migrationshintergrund“ gilt als unproblematisch und wird empfohlen, ebenso wie der „Bio-Deutsche“, sofern „Bio“ für „Biografisch“ steht und nicht für „Biologisch“. Dass zwischen verschiedenen Sorten von Deutschen unterschieden wird, das kann der rassismuskritische Leitfaden schon nachvollziehen, es soll aber nicht abwertend gemeint sein, und da gilt ausgerechnet „Migrationshintergrund“ – immerhin eine Kategorie der Ahnenforschung – offenbar als sachlich-neutrale Beschreibung. Wie das? Dieses Paradoxon erschließt sich aus anderen sprachhygienischen Vorschlägen:
„Farbige_r“ etwa, ganz unbestimmt, das geht nicht als Bezeichnung, das farblich bestimmte „Schwarze_r“ hingegen schon. „Farbig“ auf englisch geht auch, nämlich in „Person of Color“, auch „Afrodeutscher“ oder „Schwarzer Deutscher“ sind in Ordnung. Warum das? Nun, der „Farbige“ gilt als „Fremdbezeichnung“ aus der „Kolonialgeschichte“, während das englische „People of Color“ „eine Eigenbezeichnung von Menschen“ ist, „die von unterschiedlichen Formen von Rassismus in einer weißen Mehrheitsgesellschaft betroffen sind.“ Aha.
Wenn das Rassismuskritik ist, was ist „Rassismus“?
Ein kleines Zwischenfazit auf Basis der Frage: Wenn das Rassismuskritik ist, was ist dann „Rassismus“? Nun, Rassismus ist also Unhöflichkeit, völlig grundlose und sogar fundamentale Unhöflichkeit! Rassismus ist ganz, ganz schlechtes Benehmen! Es handelt sich um völlig nichtige und nichtssagende Beschimpfungen und Beleidigungen, und das ausschließlich von Privatpersonen ohne politische Bezüge, denn die gegenwärtig-demokratische Sortierung von Menschen hat mit Rassismus nichts zu tun, weswegen der „Migrationshintergrund“ auch unbedenklich ist, sprachlich! Die Bezeichnung kommt schließlich nicht aus der Kolonialgeschichte. Einen politischen Grund oder Hintergrund für „Rassismus“, für dieses sinnlos schlechte Benehmen, so etwas kennt die Broschüre „Sprache schafft Wirklichkeit“ nicht, zumindest nicht in der Gegenwart. Rassismus hatte früher was mit Politik zu tun, während des Kolonialismus, und hat sich mit dem Ende des Kolonialismus erledigt. Das heutige schlechte Benehmen rührt also – in diesem rassismuskritischen Kontext – daher, dass manche heute überholte Bezeichnungen aus der Kolonialgeschichte tradiert wurden, weswegen eine Bereinigung des Wörterbuchs ansteht.
Die Welt steht konsequent auf dem Kopf: Das schöne Wort „Bastard“ ist eindeutig eine Beleidigung und genau so gemeint. Nach der ignoranten Meinung des Glossar aber sollte stattdessen die „Herkunft der Eltern, falls diese Information relevant ist“, „konkret benannt“ werden. Leute, bitte! Beim „Bastard“ geht es doch nicht darum, eine klärende Information nachzureichen! Das Glossar übergeht locker und lässig das Motiv und damit den Grund solcher Beschimpfungen, behandelt sie damit als irrelevant, als unerheblich – geht den Weg der Ignoranz zu Ende, mit folgender Forderung: „Wörter, die als `abwertend´ oder `beleidigend´ gekennzeichnet sind, sollten nicht verwendet werden. Ein vollkommener Verzicht … ist in jedem Fall angebracht, damit diese Wörter nicht weiter reproduziert werden.“ Die Wörter mögen nicht mehr reproduziert werden! Irre! Denn auch diese Wörter drücken sehr adäquat eine Stellung – abwertend bis feindlich womöglich –, zu den adressierten Individuen oder Kollektiven aus. Dass es Gegensätze, Konflikte und echte Feindschaften gibt, die in der modernen Welt allemal als moralische Diffamierung der Gegenseite daherkommen – davon hat diese Rassismuskritik offenbar nichts mitbekommen; eine negative Stellung zum jeweiligen Objekt der Aggression beruht aus dieser Sicht auf Unachtsamkeit beim sprechen, und ließe sich leicht durch Sprachhygiene eliminieren.
Zusatzbemerkungen:
Zumindest wäre festzuhalten, dass einem, der als „Passdeutscher“ beleidigt wird, diese Bezeichnung scheißegal sein kann – sein bisheriges Problem mit der prekären Aufenthaltsbewilligung, das hat er immerhin hinter sich gelassen, und die schlechte Meinung ihm gegenüber, die ist als solche erst einmal gleichgültig. Die Sprache als solche schafft da gar nichts, schon gar keine Wirklichkeit. Falls daraus tatsächlich eine praktische, handfeste Schwierigkeit erwachsen sollte, dann kommt die nicht aus der Sprache, sondern aus den vielfältigen Über- und Unterordnungsverhältnissen, aus den Konkurrenzverhältnissen und Abhängigkeiten in der bürgerlichen Gesellschaft – Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aus Mieter und Vermieter, Klient und Amtsperson, Lehrer und Bildungsbeflissener, aus missgünstigen Kollegen und neidischen Konkurrenten.
Zum Schluss meine abweichende Bestimmung von „Rassismus“: Rassismus als Weltanschauung ist die Vorstellung, es gäbe wertvolle und minderwertige Menschensorten, Kollektive, und das Individuum ist durch die Zugehörigkeit zu „seinem“ Kollektiv bestimmt, festgelegt – egal wie es sich selbst definiert. Diese Anschauung entstammt dem vollen, prallen und gegenwärtigen Staatsleben, indem die Opfer der vielen Sortierungen für ihre Lage verantwortlich gemacht werden, durch eine schlichte Umdrehung: Das, was aus Inländern, Gastarbeitern, Migranten und Flüchtlingen von Staats wegen gemacht wird, das entspricht ihnen, es wird ihnen gerecht, indem sie so behandelt werden, wie es ihrer Höher- oder Minderwertigkeit entspricht. Das ist die rassistische Sichtweise, und die provoziert sogar gröbere Differenzen zwischen Staatsführungen und rabiaten Bio-Patrioten, entlang der Frage, ob die Staaten den Unterschied zwischen den zu Recht privilegierten Einheimischen, und den nicht so wertvollen Auswärtigen auch richtig und konsequent exekutieren.