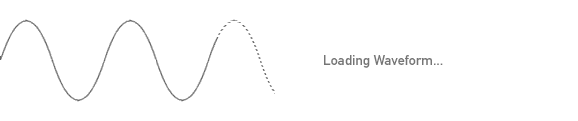Frauen im Reich des Nervenzusammenbruchs: Ganz normal
„Femizid“: „allgemein verständlich“, also ziemlich normal
Zwei – unbeabsichtigte, sehr instruktive – Beiträge zur
ÖVP-Debatte um die „Normalität“
Die ÖVP hat, ausgehend von Niederösterreich, eine Debatte um die gesellschaftliche Normalität losgetreten. Natürlich, um sich die Definitionshoheit darüber zu verschaffen – in Anlehnung an den seligen Dr. Karl Lueger: „Was normal ist, bestimm’ ich!“ Und um sich dadurch als die maßgebliche Vertretung von Hanni und Hansl Normaldenker zu positionieren. Nachdem die türkisen Protagonisten der Normalität sich manchmal schwer tun, ihre Anliegen in halbwegs normalen deutschen Sätzen zu formulieren und öfter unbedarftes Geschwurbel absondern, konsultieren wir mal Wikipedia:
„Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen.“ (Wikipedia)
Darum geht es: Normalität steht für viel mehr als bloß für mehr oder weniger weit verbreitete Verhaltensweisen; Normalität steht für die Norm, für das, was sich gehört und was sein soll, auch wenn die Welt voll von Abweichungen ist, die dadurch – argumentlos – eben als Abweichungen gekennzeichnet und dadurch schon diskreditiert werden sollen: Weil das Normale das Selbstverständliche ist, für das nicht mehr geworben oder argumentiert werden muss, oder über das auch nur diskutiert und reflektiert werden könnte, weil es über das Selbstverständliche nichts mehr zu klären gibt – so dass das Normale auf diesem billigen Weg auch von vornherein jeder Kritik entzogen ist.
„In der Psychologie bezeichnet Normalität ein erwünschtes, akzeptables, gesundes, förderungswürdiges Verhalten im Gegensatz zu unerwünschtem, behandlungsbedürftigem, gestörtem, abweichendem Verhalten.“ (ebd.)
Die Psychologie verlegt die Differenz gleich in die Individuen und deren Psyche, und erklärt das „erwünschte, akzeptable“, schlicht das angepasste Verhalten gleich zum Resultat der gesunden Psyche, im Unterschied zum „gestörten“ Seelenhaushalt, der ebensolches gestörtes Benehmen hervorbringt. Soweit die allgemeine Definition und das Interesse der ÖVP: Abweichler von dem, was sie für normal erklärt, sind gestört.
Und nun zu etwas ganz anderem, nämlich zu zwei Ereignissen aus dem realen Reich der Normalität; beide sind in keiner Weise als „abnormal“ aufgefallen … Dazu ein paar Bemerkungen.
Frauen im Reich des Nervenzusammenbruchs:
Ganz normal
Es ist offenbar möglich, die ganz normale Normalität ein bisschen zu skandalisieren, wenn auch nur im Reich der Salzburger Hochkultur, und dort einen kleinen Sturm im Wasserglas zu entfachen, durch ein Theaterstück – nach nach Meinung der Autorin: durch eine „Handgranate“ – über die weibliche „Wut, die bleibt“:
„Wohl noch nie wurde Wokeness bei den Salzburger Festspielen auf eine derart explizite Weise thematisiert, noch nie hat man hier die Themen Mutterschaft und Care-Arbeit, MeToo und Frauen-Solidarität mit einer derart expliziten Botschaft zu einem Theaterabend verrührt. … Was passiert, wenn eine Mutter beim Abendessen mit Mann und drei Kindern einfach aufsteht und sich vom Balkon stürzt? … Das Studium hat Helene abgebrochen, als sie ihr erstes Kind bekam, der Teilzeitjob, in dem sie schuftet, bis sie am Nachmittag die Kinder aus dem Kindergarten oder der Krippe holt, ist schlecht bezahlt, der Mann ein arbeitender Abwesender, die Kinder sind nicht selten eine Plage. Mit gerade einmal 40 sind alle Zukunftshoffnungen Makulatur, aus der coolen Revoluzzerin, die einmal die Welt verändern wollte, ist ein Muttertier geworden.“ (Standard 19.8.23)
Abgesehen von der dramaturgischen Übertreibung des Selbstmordes schildert das Szenario die Normalität, und zwar eine Normalität als eindeutiges, folgerichtiges Resultat einer Norm, die im Familienrecht niedergelegt ist und die dort mit Sorge-, Unterhalts- und Beistandspflicht benannt ist. Das geschilderte, weit verbreitete Arrangement ist die Folge der Kombination aus den Ansprüchen, die das Familienrecht an die Beteiligten stellt, und aus den Ansprüchen, die „die Wirtschaft“ in Gestalt der Arbeitgeberseite an Leute stellt, die Geld verdienen müssen. Der Lohn muss sich bekanntlich lohnen, für die Seite nämlich, die ihn zahlt, ist dementsprechend knapp bemessen – und das führt die Beteiligten, die damit zurecht kommen müssen und wollen, ganz pragmatisch zur normalen familiären Kombination von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung, um auch die Sorgepflicht für die Kinder einigermaßen erledigen zu können. Das hat wenig mit eigentlich „überholten, dennoch hartnäckigen Rollenbildern“ von Frau und Mann zu tun, sondern mehr mit sachgerechter Anpassung an die Umstände.
Nachdem die aus dem Fenster springende Protagonistin Helene hier als frühere „Revoluzzerin“ dargestellt wird, kann man ihr und dem „arbeitend abwesenden“ Göttergatten vielleicht sogar unterstellen, „es“ – die familiäre Aufgabenteilung nämlich – ursprünglich anders als normal, nämlich wirklich ganz gleich und gleichberechtigt organisieren zu wollen. Mit der Folge, sich dann womöglich mit schlechtem Gewissen doch in der Normalität eingerichtet zu haben, statt auf die Fehler ihrer Vorstellungen von Gleichheit und Gleichberechtigung aufmerksam zu werden.
Fehler Nr. eins betrifft die kapitalistische „Arbeitswelt“ – die ihre Ansprüche übrigens permanent umwälzt und „Flexibilität“ verlangt –, und der die Wünsche ihrer Beschäftigten in Sachen Arbeitszeit völlig egal sein können, weil die in den normalen Gesichtspunkten von Lohn und Leistung keine Rolle spielen. Derzeit werden Stelleninserate mit dem Hinweis: „Vollzeit, nicht verhandelbar“, immer normaler. Dass zwei hoffnungsvolle zukünftige Eltern bei ihren jeweiligen Vorstellungsgesprächen mit der Forderung antreten, sie würden gern Teilzeit arbeiten, sobald ein Kind da ist, und das auch noch aufeinander abgestimmt, um die Kinder gleichberechtigt betreuen zu können – so weltfremd sind auch maximal aufgeschlossene Eltern nicht; und auch nicht, sich in ihren bisherigen Jobs mit ebendieser Forderung unbeliebt zu machen. Also bleibt der Mann – häufig – in der „Vollzeit“, während die Mutter durch Mutterschutz und Karenz ohnehin den Job zeitweilig verlässt, um dann in Teilzeit „dazu“ zu verdienen.
Fehler Nr. zwei betrifft die Vorstellung, Gleichheit und Gleichberechtigung sowohl beim Geldverdienen als auch beim Kinderversorgen wären die geeignete Art, diese beiden Zwangslagen so unter einen Hut zu bringen, dass dann dennoch Bequemlichkeit und Bekömmlichkeit daraus resultieren. Dem ist aber nicht so, die Misere liegt schon an den Belastungen selbst, und die sind nicht durch fein ziselierte Gleichheiten zu mildern. Im Fall dieses Falles gingen eben beide gleich belastet und gleichberechtigt am Zahnfleisch. Die Autorin des Stücks, Frau Fallwickl, zitiert in einem Interview eine Soziologin mit der Bemerkung, „Elternschaft ist radikale Pausenlosigkeit“ – stimmt, Elternschaft, wohlgemerkt –, und eine bekannte Wiener Scheidungsanwältin fasst ihre persönlichen und die Erfahrungen ihrer Kundschaft im Resümee zusammen, dass die Normalarbeitszeit, die 40-Stunden-Woche, und Kinderbetreuung für Normalverdiener im Grunde genommen unvereinbar sind, weil spätestens mit dem zweiten Kind der „permanente Ausnahmezustand“ herrscht. Und dann gehen nicht selten die beiden früheren Liebenden aufeinander los, erstens weil kein anderer da ist, und zweitens, weil sie sich doch versprochen haben, „füreinander da zu sein“, gemeinsam ihre Sorgen und Nöte zu bewältigen, und weil eines natürlich immer stimmt: Wenn das jeweilige Gegenüber mehr erledigen würde, dann wäre das jeweilige Gegenüber besser dran …
(Ausführlich zum Nachlesen in: https://cba.media/503779)
In diesem Sinn ist auch ein anderer Topos sehr verkehrt, nämlich die Geschichte von der „unbezahlten Arbeit“. Wieder Frau Fallwickl im erwähnten Interview:
„STANDARD: Warum wird das Thema der weiblichen Care-Arbeit in unserer Gesellschaft so vernachlässigt? Fallwickl: Wer komplett mit Care-Arbeit eingedeckt ist, hat nicht die Energie, dagegen zu revoltieren. Das ist das eine, das andere ist, was man doppelte Vergesellschaftung nennt: Frauen haben mittlerweile zu Bildung und Beruf Zugang, gleichzeitig sind aber alle ihre anderen Aufgaben gleichgeblieben. Dadurch arbeiten sie quasi rund um die Uhr. Die Soziologin Franziska Schutzbach sagt, Elternschaft ist radikale Pausenlosigkeit. Auf dem Faktor unbezahlter Care-Arbeit beruht unser ganzes Wirtschaftssystem. STANDARD: Das wird nicht thematisiert.“ (Standard 5.8.23)
Die sog. „unbezahlte Care-Arbeit“ ist übrigens ständig Thema, entgegen der STANDARD-Behauptung von der Vernachlässigung. Sie wird eben geschätzt, und nicht angefeindet. Wie dem auch sei, die Bezeichnung ist hochgradig unpassend, weil eine Familie und die Elternschaft nun einmal keine Gelegenheiten zum Geldverdienen sind, zumindest nicht für die Beteiligten. „Vater“ und „Mutter“ sind keine Brotberufe, keine Jobs, bei denen aus unerfindlichen Gründen immer und immer wieder die Bezahlung ausbleibt. Die in der Familie organisierte Reproduktion der Arbeitskraft, und die Aufzucht der nächsten Generation, die sind dezidiert un-kapitalistisch aufgezogen, nicht als Tausch von Dienst gegen Geld, sondern als Pflichten der Eheleute, als Zwang. Merkt man übrigens auch daran, dass die Elternschaft nicht aufgekündigt werden kann, im Unterschied zur bezahlten Lohnarbeit. Wenn Frau für Kinderbetreuung bezahlt werden will, darf sie nicht Mutter werden, sondern wird Kindergärtnerin, Tagesmutter, Lehrerin … Kündigen geht nicht, höchstens die Vernachlässigung der Kinder, bis das Jugendamt aufmerksam wird und die Verletzung der Sorgepflicht beanstandet. Der „arbeitende abwesende“ Gatte ist in diesem sinnreichen System natürlich auch verpflichtet, nämlich unterhaltspflichtig, nicht nur für Kinder, sondern auch für die nicht oder Teilzeit-arbeitende Frau. Wenn die Frau nichts oder wenig verdient, muss das Geld, von dem die Familie leben muss, eben woanders verdient werden.
(Ausführlich zum Nachlesen in: https://cba.media/500541)
Anders gesagt: Was da „unbezahlte Arbeit“ genannt wird, ist der Sinn der Sache, das ist der „Wert“ Familie für den Staat: Dafür wird sie von der Politik moralisch verhätschelt, über den grünen Klee gelobt. Die Beteiligten kümmern sich aus Liebe umeinander, sorgen aus Liebe füreinander in diesem Arrangement, und weil die Liebe nicht selten erodiert, wegen all der Belastungen, die sie tragen soll, sorgt das Gesetz dafür, dass die Leistungen, die sie bringen soll, nach der Scheidung weiter erbracht werden, auch wenn sich die Beteiligten einfach nicht mehr aushalten …
„Familie gibt Halt, Sicherheit und Geborgenheit in jeder Lebenslage. Wichtige Aufgabe der Politik ist es daher, die erforderlichen Rahmenbedingungen anzubieten, damit die Familien in Österreich weiter gestärkt werden, um den Alltag und die Herausforderungen des Lebens bestmöglich meistern zu können.“ (Regierungsprogramm türkis-blau 2017)
Prägnanter kann man es nicht formulieren. Die Familie ist die staatlich organisierte und orchestrierte Instrumentalisierung der Liebe für die Bewältigung der Härten eines Lebens im Kapitalismus. Der Kapitalismus tritt hier wie oft unter Pseudonymen und Verkleidungen auf, als „Alltag“ oder als die „Herausforderungen des Lebens“ oder einfach als „jede Lebenslage“, die ganz naturwüchsig das Bedürfnis nach „Halt, Sicherheit und Geborgenheit“ provoziert, und frustriert. Dieser dauernde Bedarf wird offenbar in den anderen Abteilungen der Gesellschaft hervorgebracht und nicht befriedigt, man darf ihn sowohl moralisch als auch materiell verstehen, und die Familie ist der große Lückenbüßer und Notnagel für alles und jedes. Der Vollständigkeit halber die kleine Akzentverschiebung im aktuellen türkis-grünen Programm:
„Familien sind die wichtigste(!) Gemeinschaft der Menschen. Familien geben Halt, bieten Schutz und Zuversicht und helfen einander in schwierigen Lebenslagen.“ (Regierungsübereinkommen türkis-grün 2020) – Wie bei türkis-blau gehabt, wo die schwierigen Lebenslagen herkommen, weswegen Leute Halt, Schutz und Zuversicht von der Familie fordern sollen, steht nicht da. Da hat man womöglich im Sozialkunde-Unterricht gehört, eine menschenrechtlich orientierte Demokratie, ein Rechtsstaat und ein Sozialstaat hätten so viel zu bieten in Sachen Halt und Sicherheit und Schutz, von einer vernünftigen marktwirtschaftlichen Ökonomie ganz zu schweigen – und dann bleibt doch alles an der Familie hängen …
Aber immerhin: „Die neue Bundesregierung anerkennt die Vielfältigkeit unterschiedlicher Familienmodelle, die Kindern ein gutes Leben ermöglichen.“ (ebd.) Die Vielfältigkeit von Familienmodellen wird neuerdings betont – damit also nicht nur das traditionelle heterosexuelle Paar aus Mutter und Vater in den Genuss der Familie kommt.
„Femizid“:
„Allgemein verständlich“, also ziemlich normal
„Ein 34-Jähriger ist am Montag im Landesgericht Leoben wegen Totschlags an seiner Ex-Frau zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen. Der Mann gestand die Messerstiche, sein Verteidiger Bernhard Lehofer sprach aber von einer ‘allgemein begreiflichen heftigen Gemütsregung’. Die Geschworenen entschieden, dass es kein Mord, sondern Totschlag war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. … ‘Ja, es war mit unfassbarer Brutalität, aber ein klassischer Affektsturm’, so Lehofer. Wenn es geplant gewesen wäre, hätte er nicht dutzende Male zugestochen, während die anderen oben in der Wohnung waren, ‘das ist dumm’. Die Tat sei unvertuschbar gewesen.“ (Standard 14.8.2023)
„Die Motive für den brutalen Mord an einer 34-jährigen Steirerin, der am Montag in Leoben verhandelt wird, sind nicht neu: gekränkter Stolz, Wut, Demütigungen und eine neue Liebe. … ‘Mein Leben zerbrach in tausend Teile’, weint er.“ (krone.at, 14.8.2023)
Auch der Spruch der Geschworenen, der auf Totschlag und nicht auf Mord lautet, darf wohl als Beitrag zur Debatte um Normalität gewertet werden; vor allem, weil sie offenbar den Ausführungen des Verteidigers von der „allgemein begreiflichen heftigen Gemütsregung“ – also einer ziemlich normalen Reaktion – gefolgt sind, was immerhin den Unterschied von sieben oder zwanzig Jahren Haft bedeutet. Der Anwalt hat mit der „unfassbaren Brutalität“ „argumentiert“, die einen „Affektsturm“ unterstelle, was nicht auf Planung hindeute. Was denn nun – „allgemein begreiflich“ soll die heftige Gemütsregung schon sein, also ziemlich menschlich verständlich, im Sinn von noch tolerierbaren Beweggründen im Rahmen eines normalen Gefühlshaushalt, aber Absicht soll es nicht gewesen sein?! Wie auch immer, die juristische Einordnung ist hier nicht Thema, aber beim „allgemein begreiflichen Affektsturm“, der den Täter überwältigt, handelt es sich um nichts Fremdes, das, was da den Täter überkommt, so dass er bei der Tat „außer sich“ ist, das ist sein eigener Standpunkt. Den Hass, der sich in diesem „Hassverbrechen“ äußert, den hat niemand anderer kultiviert und genährt; juristisch-dialektisch-ironisch formuliert: Es kommt sein eigener Vorsatz als Affekt über ihn.
Sein Leben „zerbrach in tausend Teile“, äußert sich der Täter. Der Genauigkeit halber: Nicht „es zerbrach“, sondern sie hat es zerstört, aus seiner Sicht; und das hat er ihr heimgezahlt. Das so „allgemein begreifliche“ ist nichts als die in der Tat ganz normale moralische Dreifaltigkeit von früher einmal versprochener Loyalität – altmodisch „Treue“ –, von Verrat, und Rache. Wenn ein Nutzen weit und breit nicht erkennbar ist – Frau tot, Täter im Knast – dann ist immer der Verdacht auf die Moral als Motiv angebracht, auf die verletzte Ehre des Täters. Es ist bei der Selbstjustiz des Beziehungstäters wie beim Strafrecht: Nirgends ist ein Nutzen absehbar; das Opfer bleibt tot, die Gewalt des Staates unterwirft den Täter dem Recht und steckt ihn ins Gefängnis, aber insgesamt kein Nutzen weit und breit …
Ein Addendum im “Standard” bei den thematisch einschlägigen Artikeln lautet:
„Monatlich werden in Österreich im Schnitt drei Frauen ermordet, zählt der Verein Autonome Frauenhäuser (AÖF). Die Täter stehen häufig in einem Beziehungs- oder Familienverhältnis zum Opfer und haben nicht gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Morde an Frauen werden auch als Femizide bezeichnet. Der Begriff soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden oft keine individuellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme wie etwa die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder stehen.“ (Standard)
Nun, der Täter will gar keinen „Konflikt lösen“, er will Gerechtigkeit in Form der individuellen Rache; und Gewalt ist allemal das Mittel des Rechts, in dem Fall der Selbstjustiz für alle Untaten, die der Täter dem Opfer im „Victim-blaming“ anlastet. Und die Entgegensetzung – „keine individuellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme“ – ist auch verkehrt. Es muss vielmehr heißen: Gesellschaftliche, normale, eben „allgemein verständliche“, und deswegen individuell einleuchtende moralische Stereotypen stehen da im Raum.
Ausführlich zur Familie: