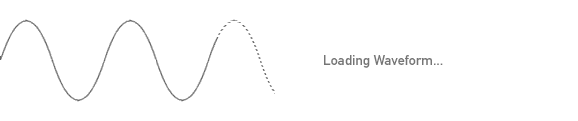Zum Zusammenhang von Demokratie und Faschismus und Populismus: Zwei kleine Fallstudien
Gedenkfeiern in Mauthausen, 2017:
„Aba Lewit, ein Überlebender, der sich Fragen der Journalisten stellte, gab der Jugend als Rat mit, zwischen den Zeilen zu lesen, ‘nicht reinfallen auf Lockungen’. ‘Es ist komischerweise immer das Gleiche, die Menschen lernen nicht’, sie würden Versprechungen glauben, dabei sei ein Populist nur ein besserer Faschist.“ (Standard 7.5.2017, https://www.derstandard.at/story/2000057128433/7-000-gedenken-in-mauthausen)
Also „die Menschen“ lernen nicht. Aber offenbar lernen sie doch etwas, nämlich „immer das Gleiche“, indem sie „Versprechungen glauben“ und auf „Lockungen reinfallen“! Welche „Versprechungen“ und „Lockungen“ sind da unterwegs, die den „Populisten“ womöglich als den „besseren Faschisten“ entlarven?
Populismus – die Synthese von Demokratie und Faschismus?
Populismus – also „das Beste aus zwei Welten“?
Fortsetzung vom letzten Beitrag: Wenn die nationalen Erfolge ausbleiben, wenn der Staat in eine Krise gerät, dann entzweien sich die Parteien unter Umständen über die fälligen Konsequenzen, über den weiteren Erfolgsweg der Nation, und dann gehen sie auch anders miteinander um, bzw. dann gehen sie gegeneinander vor. Mit den Mitteln, die der Staat auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Instanzen so zu bieten hat. Für Faschisten / Populisten / Autokraten ist die Politik dann nicht mehr der bisherige demokratische „Konsens durch Kompromiss“, sondern der „Kampf“, und zwar auch und erst recht nach innen, gegen innere Feinde, weil die Nation nur geeint gegen das Ausland bestehen kann – weswegen die Proponenten faktisch den „Konsens der Demokraten“ kündigen und ihren Konkurrenten zuerst die moralische Legitimität als ordentliche „Mitbewerber“ bestreiten, und ihnen dann die Machtpositionen und Möglichkeiten streitig machen wollen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Zwei „Fallstudien“: Ungarn unter Orbán und die USA unter Trump.
Die ungarische Avantgarde
Dass sich der dortige Chef Orbán vom „Liberaldemokraten“ zum „Populisten“, womöglich zum nationalistischen „Autokraten“ weiterentwickelt hat, mit faschismusverdächtigen Errungenschaften, das ist bekannt und wird gern stirnrunzelnd erwähnt. Die Frage, warum eigentlich, die wird weniger gern gestellt, wird also hier beantwortet. Bekanntlich war nicht Griechenland, sondern Ungarn – das den Euro nicht eingeführt hat – das erste Land der EU, das im Zuge der damaligen Finanz- und Staatsschuldenkrise pleite war, schon im Jahr 2008, also ganze vier Jahre nach dem hochgelobten und ersehnten Beitritt zur EU.
„Von der Weltfinanzkrise 2007–2008 war Ungarn besonders stark betroffen. Wegen des hohen Doppeldefizits (Leistungsbilanz und Staatshaushalt) und der hohen Verschuldung der privaten Haushalte, die zu erheblichen Teilen in Fremdwährungen erfolgte, erlitt der Forint gegen den Euro im Oktober 2008 erhebliche Kursverluste. Die Zentralbank erhöhte daraufhin den Zins um drei Prozentpunkte. Außerdem musste die Europäische Zentralbank Ungarn einen Swap in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen, weil ungarische Banken die Vergabe von Devisenkrediten weitgehend eingestellt hatten. Nachdem auch der Markt für ungarische Staatsanleihen wegbrach, bat Ungarn den Internationalen Währungsfonds um Hilfe. Am 27. Oktober 2008 gab der IWF bekannt, Ungarn mit einem Rettungspaket zu unterstützen, um den sonst unausweichlichen Staatsbankrott Ungarns zu verhindern. Die Europäische Union und die Weltbank beteiligen sich ebenfalls an dem Rettungspaket; insgesamt wurde Ungarn ein Kredit über 20 Milliarden Euro zugesagt. Am 21. November 2011 bat die ungarische Regierung vorbeugend den Internationalen Währungsfonds und die EU erneut um finanzielle Unterstützung. Die Rendite auf ungarische Staatsanleihen war in den Monaten zuvor sukzessive angestiegen, wodurch sich auch die Refinanzierung der Schulden verteuerte. Am 23. Mai 2014 beendete der IWF die ‚Article IV consultation‘. Ungarn zahlte Kredite des IWF vorzeitig zurück.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn#Geschichte_seit_1989
Zu den Bedingungen des IWF 2008 für die Überbrückungskredite gehörte auch die übliche – höflich formuliert –, Mitsprache über die Staatsausgaben und -einnahmen; für jeden veritablen Staatsmann ist das eine inakzeptable Demütigung durch die Fremdherrschaft des internationalen Finanzkapitals, alias IWF. Über die fälligen Konsequenzen hat sich die politische Klasse in Ungarn gespalten, genauer gesagt, über die Stellung zur EU. Die bisherigen Regierungsparteien interpretierten die Staatspleite als Karriereknick auf einem im Prinzip richtigen Weg des Weitermachens innerhalb der EU, auf Basis des gemeinsamen Rechtsbestandes. Nicht so Orbán und sein Anhang, seine Partei wurde dafür zwei Jahre nach der Pleite mit Zweidrittelmehrheit – in Ungarn die Verfassungsmehrheit – gewählt. Für den war die Zahlungsunfähigkeit die schwere Niederlage der Nation, die den bisherigen Weg nachhaltig blamiert, die generelle Richtung desavouiert: Mit dem nunmehr einzig richtigen kapitalistischen System und als Mitglied der EU kommt die Nation ganz zwangsläufig voran! Eben nicht! Ein „weiter so, Ungarn!“ kam nicht mehr in Frage; das Mitmachen in der EU schädigt die Nation, dabei konnte es nicht bleiben:
„Wir müssen Schulden wie einen Kriegsgegner betrachten. Wenn du den Feind nicht besiegst, dann wird er dich besiegen … Eine Nation kann man auf zwei Arten unterjochen: Schwert und Schulden.“ (Orbán, Interview mit krone.at 10.6.2011)
Die Nation ist im Krieg; seither lautet die Linie „In der EU – gegen die EU!“ Also gegen die Prinzipien, die in die Pleite geführt haben. Für Orbán und Konsorten sind die Regularien des Binnenmarktes nicht mehr die alternativlosen, weil rein ökonomisch vorgegebenen und quasi „neutralen“ Sachgesetze des gemeinsamen Wirtschaftens, sondern „bloß“ die Prinzipien, die sich die Vormächte der EU im eigenen Interesse zugelegt und den neuen Mitgliedern im Osten ohne Rücksicht auf deren Nöte und Besonderheiten aufgezwungen haben; sie sind also die Mittel eines innereuropäischen Imperialismus, gegen den es nun anzutreten gilt. Der Mann vergleicht ja gern die EU mit dem früheren sowjetischen Unrechtssystem im Ostblock. Seither misst er die Wirkungen des Binnenmarktes, die europäische Rechtslage und die europäischen Beschlüsse radikal am ungarischen Interesse, verlangt Extratouren und betreibt Obstruktion – vom Standpunkt der Euro-Mächte und der EU-Kommission. Etwa durch Versuche, die ökonomische Abhängigkeit Ungarns von der EU durch bessere Beziehungen mit Russland, China und der Türkei zu mildern. Russland baut ein AKW in Ungarn. China ist prominent als Investor (Batterieautos!) und über die Seidenstraßen-Initiative präsent. Diese Sorte Kampf gegen die EU, diese Wende der ungarischen Politik hat Konsequenzen für die innere Ordnung.
„Seit Amtsantritt des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Jahr 2010 wird das Land jedoch wieder zunehmend autoritär regiert. Daher leitete die Europäische Kommission 2022 erstmals ein Rechtsstaatsverfahren gegen ein Mitgliedsland ein. Ebenso sprach das Europäische Parlament erstmals einem Mitgliedsland ab, eine Demokratie zu sein. … Nach einem Jahrzehnt der Fidesz-KDNP-Führung unter der Leitung von Viktor Orbán stufte der Bericht ‘Nations in Transit 2020’ des Freedom House Ungarn von einer Demokratie in ein Übergangs- oder Hybridregime ab. Dem Bericht zufolge ‘hat das rechte Bündnis … die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn allmählich untergraben und eine strenge Kontrolle über die unabhängigen Institutionen des Landes eingeführt … [das rechte Bündnis] hat die ungarische Verfassung stetig umgeschrieben und demokratische Schutzmechanismen, die im Verfassungsgericht, der Staatsanwaltschaft, der Medienbehörde und dem staatlichen Rechnungshof gesetzlich verankert sind, abgeschafft …’. Es beschränkte auch die parlamentarische Kontrolle, unabhängige Medien, Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler und festigte gleichzeitig die Macht um die Zentralregierung.“ (wikipedia)
Denn um die Nation nachhaltig zu retten, muss der Retter des Vaterlandes vor allem einmal seine Macht sichern, sie dem potentiellen Zugriff demokratischer Konkurrenten entziehen, und seine Linie einzementieren. Naheliegend dabei die Abschaffung oder zumindest die Zurichtung der Gewaltentrennung: Also Kontrolle der „vierten Gewalt“ der Medien, nicht nur, um den anderen Parteien, die faktisch eben nicht mehr zu den „legitimen Mitbewerbern“ zählen, das Verbreiten ihrer Positionen schwer zu machen, sondern auch um die übliche, beliebte, demokratisch normale „Erfolgskontrolle“ und gegebenenfalls Blamage durch unabhängige Medien zu bremsen. Gleichschaltung soll sein, Propaganda ist gefragt. Einschränkungen durch verfassungsrechtliche Bestimmungen braucht die Regierung nicht zu gewärtigen, weil sich die Orbán-Regierung über ihre Verfassungsmehrheit schon eine neue geschrieben hat, und diese immer wieder anpassen kann. Die unabhängige Justiz und übliche Kontrollmechanismen wie Rechnungshof und Parlament sind ebenfalls zweckmäßig umgestellt. Die Ausgestaltung des Wahlrechts steht immer zur Disposition; Kunst, Kultur und Wissenschaft sind durch eine entsprechende Personalpolitik und organisatorische Reformen auf Linie. Die ökonomische Privatmacht des großen Geldes wird – eben als private Macht – von der Regierung argwöhnisch beobachtet, vor allen, wenn sie aus dem Ausland kommt; soweit möglich werden daher politisch zuverlässige Parteigänger bei Aufträgen, Ausschreibungen etc. bevorzugt, was von der Opposition gern als Korruption beanstandet wird, aber zumindest innerhalb Ungarns ist die Justiz diesbezüglich loyal zur Regierung.
Das ungarische Volk, das zur Kampfgemeinschaft geformt wird, dem wird einiges zugemutet, für den guten Zweck seiner Behauptung nach außen – etwa für die vorzeitige Tilgung der IWF-Kredite; es wird historisch-nationalistisch-religiös indoktriniert, um es gegen die Feinde des Vaterlandes zu immunisieren. Besondere Aufmerksamkeit genießt die ungarische Keimzelle des Staates als die Zuchtanstalt des ungarischen Nachwuchses, weswegen die Familie als die alternativlose, naturgegebene Form des Zusammenlebens gehandelt wird, so dass schon die Schuljugend vor Informationen über schwule „Abweichungen“ geschützt wird. – Zusammengefasst wird das alles im Schlagwort von der „illiberalen Demokratie“: Selbstverständlich handelt Orbán im Namen des ungarischen Volkes und für das Volk, nur dafür wird das Volk strapaziert – aber mit individuellen Freiheiten und Vorlieben als Leitmotiv des ungarischen Staates, auf dass ein jeder nach seiner Fasson durch so Sachen wie „Selbstverwirklichung“ selig werde, gern denunziert als die Verirrungen der 68er-Bewegung, damit hat das nichts zu tun: Das Volk steht im Kampf, ein jeder hat an seinem Platz seine Pflicht zu tun.
„Im Dienste machtvoller nationaler Erneuerung machen sich Orbán und seine politischen Mitstreiter daran, die ganze Nation dem im Fidesz repräsentierten staatlichen Auf- und Ausbruchswillen unterzuordnen. Ungarn soll von Grund auf neu aus- und aufgerichtet werden. Der nationale Machtapparat soll zu einem schlagkräftigen Instrument des Wiederaufstiegs unter ihrer Führung hinorganisiert, die ganze ungarische Gesellschaft als Basis nationaler Machtentfaltung auf diesen staatlichen Kampfauftrag orientiert und für ihn praktisch in die Pflicht genommen werden.
‘Das Land erwartet von uns, dass wir das ganze System zerstören, nicht nur einige Elemente, und ein komplett neues aufbauen.‘ (Orbán, Paket an Wirtschaftsmaßnahmen, 8.6.10)“
Das Volk ist schließlich das Mittel im Kampf gegen das Ausland.
Wer also mehr über die Wende in Ungarn wissen will, jenseits der öden Botschaft, dass Orbán einfach nicht das macht, was „wir“ von ihm wollen: hier eine Empfehlung zur ausführlichen Lektüre.
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/krisenbewaeltigung-ungarn
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/ungarn-krisenbewaeltigung-zum-aufstand-gegen-eu-regime
Der amerikanische Aufbruch
Verglichen mit Ungarn scheint die amerikanische Wende unter Trump – die beiden sind immerhin zwei Kumpels im Geiste und voneinander schwer begeistert – weit hergeholt und schwer nachvollziehbar: Ungarn war ja in der Tat pleite, aber was hat denn nun den Immobilientycoon dazu veranlasst, dem kompletten Establishment in Washington einen Niedergang Amerikas anzulasten, und dem daher den Kampf anzusagen – die republikanische Partei eingeschlossen, bis die sich ihm unterwarf? Lässt sich aus den öfter doch erratischen Ausritten und Aktionen des Entrepreneurs überhaupt so etwas wie eine politische Linie herausarbeiten, die dem Slogan „America first“ oder „Make America great again“ Ziel und Inhalt verleiht?
Nun, im Grunde genommen hat Trump dem bisherigen Modus der „Globalisierung“, dem imperialistischen Gesamtkunstwerk namens „regelbasierte Weltordnung“ eine Absage erteilt, ihr eine radikale Revision angesagt. Er hat das komplette System weltweiter ökonomischer Beziehungen im Visier, das die USA seit dem Sieg im letzten Weltkrieg aufgebaut haben, und das im Grunde genommen ausgerechnet Russland und China durch ihre Wende zum Kapitalismus als globales System vollendet haben. Was den Mann derart stört, hat er in der ihm eigenen prägnanten Art oft genug zusammengefasst:
„Ich denke, die Europäische Union ist ein Feind Amerikas, was sie uns im Handel antun.“ (Trump, 2018) Da konnten EU-Politiker noch so oft die Notwendigkeit einer transatlantischen Handelsfront gegen den eigentlichen, fernöstlichen Gegner beschwören, es hilft nichts: „Die EU ist noch schlimmer als China.“ (Trump, in Davos 2020) Dafür, dass er mit der EU überhaupt als Kollektiv verhandeln muss, hat Trump bis heute kein Verständnis – und auch keine Scheu, den EU-Mitgliedsstaaten das britische Vorbild anzuempfehlen, um den Club noch einige Köpfe kleiner und machtloser zu machen.
Im Verhältnis der USA zu Europa und China – da ist aus seiner Sicht etwas ganz gewaltig schiefgelaufen; was eigentlich? Er hat zur Kenntnis genommen, dass mit der EU und China, mal rein ökonomisch betrachtet, kapitalistisch wirtschaftende Giganten hochgekommen sind, und zwar innerhalb dieser „regelbasierten Weltwirtschaftsordnung“, also durch Befolgung von und Unterordnung unter deren Prinzipien, wodurch sie die jahrzehntelange fraglose ökonomische Dominanz der USA bei der kapitalistischen Bewirtschaftung der Welt – der „Globalisierung“ – einigermaßen aufgeweicht haben. Und für fremde, womöglich gegnerische Erfolge war diese Weltwirtschaftsordnung nun einmal nicht gedacht, das formuliert Trump offen und unverblümt. Insofern liegt in diesen Resultaten der Konkurrenz auf dem Weltmarkt eine riesige, inakzeptable Ansammlung von lauter Ungerechtigkeiten vor, die Amerika nicht länger hinnehmen kann. Das besondere an Trump, verglichen mit seinen Vorgängern und Konkurrenten in den USA, ist erst mal die Kompromisslosigkeit, mit er dieses Resultat als Verrat des Establishments in Washington an seinen geliebten hart arbeitenden Amerikanern vorträgt. Alle Sorgen und Nöte dieser geliebten Amerikaner, der working poor, kommen daher, dass sich Amerika zu viel gefallen lässt, vom Ausland insgesamt und von Europa und China speziell, woran wieder die „Eliten“ an der Macht schuld sind. Das ökonomische Miteinander der Völker, das ist keine harmonische Veranstaltung zum allseitigen Nutzen aller Beteiligter, wie die Ideologen des Freihandels gern behaupten. Das ist vielmehr eine beinharte Konkurrenzveranstaltung, in der es den Reichtum der Nationen und den Wohlstand der Völker – damit auch die berühmten jobs – nur als Objekt und Resultat eines immerwährenden Ringens, eines wechselseitigen Wegnehmens und Vorenthaltens gibt. Und insofern sind die Regeln des „regelbasierten“ Miteinander in Sachen Weltmarkt inzwischen zutiefst unfair gegenüber den USA. Auch wenn sie letzten Endes die Urheber dieser Regeln sind, bzw. gerade deswegen hält der Mann es für eine Zumutung, dass sich die USA daran halten oder gehalten haben, und derartige Konkurrenzerfolge der EU oder Chinas zugelassen haben!
Ganz grundsätzlich braucht Trump gar nicht den Nachweis bestimmter, Amerikas Interessen diskriminierenden Bestimmungen, um sich insgesamt ablehnend zu multilateralen zwischenstaatlichen Vereinbarungen zu stellen, in denen die USA als eine Vertragspartei unter anderen vorkommen und auch auf irgendetwas verpflichtet werden. Die Konvention zum „Klimaschutz“ war damals ein exemplarischer Fall: Entscheidend für sein „Nein“ dazu waren schlicht alle Ge- und Verbote in Sachen Energiepolitik, die seiner Ansicht nach Amerikas Handlungsfreiheit und damit, das ist für Trump identisch, das Ausspielen amerikanischer Überlegenheit im Weltgeschäft behindern würden. In all seiner Abstraktheit und Radikalität ist das der Vorwurf, den der damalige Präsident und nunmehrige Kandidat dem Establishment überhaupt macht, und das will er beenden: eine Politik der Preisgabe nationaler Konkurrenzerfolge. Amerikanische Überlegenheit und das nicht zu relativierende Recht des Überlegenen, seine Überlegenheit voll und uneingeschränkt auszuspielen – daran gemessen nehmen sich internationale Abmachungen als Fesseln für die USA aus. Was als „unfair“ zurückgewiesen wird, ist jede Einschränkung des Rechts des Stärkeren im Verkehr mit den Konkurrenten.
Mit Trumps Kritik an den Ergebnissen des Außenhandels als Rechtsverletzung und als unfaire Fesselung des amerikanischen Riesen ist der Standpunkt der Korrektur angesagt, die das Recht des Stärkeren zu ihrer Leitlinie macht. Aus Erpressungsgeschäften dieser Art besteht natürlich schon immer das Programm der amerikanischen Weltpolitik; genau das hat schließlich die „regelbasierte Weltordnung“ erst hervorgebracht, damals in der Situation nach dem Weltkrieg. Umso auffälliger der Standpunkt eines Trump, Amerika müsste unter seiner unentbehrlichen Führung seinen Zugriff auf die externe Staatenwelt erst wieder richtig zur Geltung bringen.
*
Wenn der Mann seine Wahlniederlage nicht akzeptiert – er zuerst biedere Beamte im Dienste der Stimmenzählung mit der Beschaffung fehlender Wahlkreuze beauftragt, und dann einen Mob aufhetzt, um durch einen Sturm auf das Kapitol die formelle Ratifizierung seiner Niederlage zu verhindern – dann erweitert das schon die demokratischen Usancen. Kongenial jedenfalls die Fortsetzung seiner politischen Linie durch seinen demokratisch gewählten, noch amtierenden Nachfolger: Der startet unter dem Titel „Inflationsbekämpfung“ eine Offensive im Interesse des US-Kapitalstandorts, die sich von der Wirkung her als Wirtschaftskrieg gegen den Rest der Welt geltend macht. Und der verhindert durch passende Zollerhöhungen gezielt chinesische Importe, und will eine erfolgreiche social-media-Plattform chinesischen Ursprungs zum Verkauf zwingen …
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/donald-trump-welt#section9
https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/westen-einem-jahr-trump