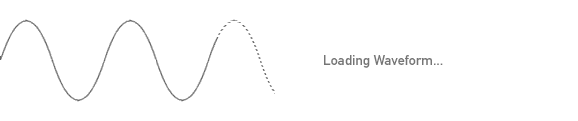„Der Fluß“ („El riu“). Ein seltsamer Titel für eine Erzählung, in der alles stockt. Eine Unzahl müder Arbeiter wollen am Abend so schnell wie möglich die beschwerliche Fahrt nach Hause hinter sich bringen, kommen aber nicht aus der Metrostation. Aus irgendeinem Grund stauen sich die Massen vor dem Ausgang, und das Gedränge reicht immer weiter Richtung Bahnsteig. In der Erzählung von Maria Aurèlia Capmany aus der letzten Sendung ging es um eine Frau, welche die ganze Erzählung über ihr Haus nicht verlässt – obwohl diese Erzählung ihr ganzes Leben umspannt. Selbst nach ihrem Tod liegt sie aufgebahrt vor jener Perspektive, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Sie hatte ihr ganzes Leben nur die Perspektive nach außen, das mit einem Geländer begann (das Gleichzeitig als Grenze daran hinderte dieser Perspektive zu folgen) und führte über einen Zitronenbaum übers Meer, das in der kindlichen Welt noch in die Unendlichkeit führt, was auch immer alle Leute von der Erde als Kugel erzählen.
In Capmanys Erzählung kommt es nie zu einem Drang nach draußen, in der Erzählung von Joaquim Carbó ist er das einzige Ziel. Kein Ziel, das mit hoffnungsvollem Schwung angestrebt wird, weil es irgendwohin führen würde. Sondern ein Ziel, dass auch nur scheinbar ein Ziel ist, denn es führt nur weiter in einem ewigen Kreislauf aus Frustration, Demütigung und Aggression gegenüber denjenigen, die das eigene Schicksal teilen. Hier gibt es keine Familiengeschichten mehr, keine Namen, sondern nur noch den Platz in der Masse, die Relation des Einzelnen zu denen, die vor ihm stehen, und denen die hinter ihm stehen, all das determiniert durch das Interesse in der präkären Situation die eigene möglichst zu verbessern, aber doch wenigstens zu halten.
Die letzte Lesung, die noch in Wien aufgenommen wurde, sollte sowohl zu den beiden vorangehenden Lesungen passen, als auch die Perspektive Richtung Buchmesse öffnen. Daher eine Erzählung, die das Erzählen selbst zum Thema hat. Erzählt wird von den Qualen eines namenlosen, aber kompromisslosen Schriftstellers, der jedem Detail eines Textes so viel Bedeutung zukommen lässt, wie dem gesamten Text. Und der vielleicht genau deswegen vorschnelle Entscheidungen trifft. „Die Erzählung“ von Quim Monzó.
Großbürgertum in Erstarrung oder Niedergang – Arbeiterklasse in Aufbruch und Resignation. Das sind zwei Konstanten, welche die katalanische Literatur durchziehen (dabei wird aber der Gegenüberstellung wegen willentlich auf die Erzählungen und Romane vergessen, eine ebensolche Konstante). Aber beides gehört in dieser Form der Vergangenheit an. Die Gegenwart wird eingeholt im neuesten Roman von Carme Riera „Der englische Sommer“ („L’estiu de l’anglès“). Der Roman entwickelt sich – wie in der Exposition explizit dargelegt wird – aus einer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation: Die im Frankismus propagierte Abschottung Spaniens als Versuch eine angebliche Glanzzeit Spaniens wiederherzustellen – unberührt von Einflüssen aus dem Ausland – hat dazu geführt, dass bis heute die Fremdsprachenkenntnisse in ganz Spanien gering bis nicht vorhanden sind. Auslöser dafür, dass Laura, die Heldin des Romans einen Sommer in England verbringt, um einen Sommer abgeschottet auf einem Landgut zu verbringen, um mit der Lady, einer alten etwas gespenstischen Frau, Englisch zu lernen. Mehr kann hier nicht verraten werden, denn die Lesung, die erste im ORANGE 94.0 Schwerpunkt, die schon aus Frankfurt kommt, hat selbst nicht mehr von diesem Roman preisgegeben. Den Anfang macht die Autorin selbst, die zunächst ein kürzestes Stück aus ihrem Roman „In den offenen Himmel“ („Cap al Cel Obert“) liest, und danach ein ebenso kurzes Stück aus „L’estiu de l’anglès“, gefolgt von zwei Ausschnitten der deutschen Übersetzung des Romans, gelesen von Birgitta Assheuer.
Sämtliche Informationen und Downloads zum Schwerpunkt „Katalanische Literatur“ in der ORANGE 94.0 Kulturschiene gibt es unter frankfurt.o94.at im Überblick.