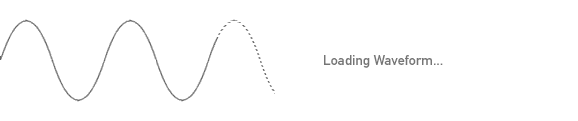Die Familie
Ort des Glücks,
Ort der unbezahlten Arbeit,
Ort des Psychoterrors,
Ort des Amoklaufs
Da haben sich die Leute für ihre freie Zeit eine separate Welt gesucht und gefunden – jenseits von Lohnarbeit und Warentausch und Leistung, wo selbstsüchtige Privateigentümer gegeneinander agieren. Sie haben beschlossen, auf der Basis von Zuneigung gemeinsame Sache zu machen, vielleicht auch mal Einkommen und Ausgaben zusammenzulegen; es sollte jedenfalls gerade nicht um einseitiges Ausnutzen und um Vorteile gegen den anderen gehen – und wozu bringen sie es nicht selten im Verlauf, und unterm Strich? Zu einer komplizierten, hoch-moralischen Form des Tausches, bei dem oft einem oder beiden Partnern der Ertrag in keinem guten Verhältnis zur eigenen Leistung zu stehen scheint: Weil eben nicht mehr etwas bestimmtes – begrenztes – gehandelt wird. Sie tauschen vielmehr Selbstlosigkeit, bedingungslose Zuwendung, um vom Partner dasselbe einzutauschen – und achten sehr auf das Verhältnis von Geben und Nehmen. Eine sehr dialektische Angelegenheit: Gerade durch Selbstlosigkeit, durch den Abstand von einseitigen Vorteilsrechnungen soll das Individuum im Gegenzug auf seine Kosten kommen. Vor allem hat es das Gut, das da wechselseitig beansprucht wird, in sich. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um ein letztlich doch gelungenes Leben: Neben einem sog. Alltag, der einem das Leben mehr oder weniger schwer macht, soll das gemütliche Nest einen für das entschädigen, was der Alltag nicht zu bieten hat. Dagegen ist der übliche Tausch von Waren und Diensten der Individualität äußerlich, abtrennbar, ein begrenztes Ding betreffend, richtiggehend harmloser. Der Tausch unter Eheleuten oder in der Beziehung ist viel besitzergreifender. Und insofern auch gefährlicher. Es gibt eine Formulierung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, die darauf anspielt: Da sind die Opfer manchmal ein wenig fassungslos, denn der Täter wird als „Seele von Mensch“ beschrieben, der alles für die Familie tut, von dem Frau und Kinder alles haben können – und trotzdem dreht er ab und an durch und wird ausfällig. Nun, das trotzdem ist m.E. durch ein „weil“ zu ersetzen; weil er alles gibt, hat er verdient, im Gegenzug auch alles zu bekommen – da kann manche Enttäuschung nicht ausbleiben.
Immerhin eine Kritik an der Ehe: Überforderung!
In dem schon erwähnten Buch „Tatort Trennung“, von Heidi Kastner – Fachärztin f. Psychiatrie und Neurologie, auch Gerichtspsychiaterin –, auf welches ich zurückkommen will, findet sich eine Kritik an der Ehe. Die Autorin gibt zu Protokoll, dass die „Beziehungstat“ und die „Familientragödie“ schon etwas mit dem modernen Beziehungsmodell bzw. mit der Familie zu tun hat. Nämlich mit den Idealvorstellungen, die sich in Erwartungen geltend machen, und die durchaus folgerichtig zu gewaltigen Enttäuschungen führen können:
„Mit dem Aufstieg des Bürgertums (und der Romantik) wurde das fatale Ideal der eierlegenden Wollmilchsau in die Welt gesetzt: Ehe, Liebe und Sexualität sollten in Kombination gelebt werden können.“ (S. 19, Heidi Kastner, „Tatort Trennung“)
„Mit dem Aufstieg des Bürgertums“ – das ist erst mal auch eine Erinnerung an eine Tatsache, die heutzutage als nicht selbstverständlich gilt; dass nämlich in dieser Sphäre gar nichts „natürlich“, „naturgesetzlich“ oder gleich „biologisch determiniert“ ist, auch wenn von Verhaltensforschern bis zur FPÖ die Idee kursiert, das Ensemble aus Familienrecht und den Neigungen der Beteiligten müsste so oder so ähnlich ablaufen wie beim lieben Vieh. Die Frau ist da schon mal die geborene „Brutpflegerin“, wie bei Amsel, Drossel, Fink und Star … Nein, da ist nicht die Natur, da ist schon die bürgerliche Gesellschaft, als da sind staatliche Gesetze, gesellschaftliche Konventionen, die Bedürfnisse der Teilnehmer und die Sittlichkeit der bürgerlichen Community – die sind am Werk.
Das fatale Ideal der eierlegenden Wollmilchsau besagt, dass der Beziehung oder der Familie zu viel abverlangt wird; Leistungen, die in Summe gar nicht zu erbringen sind. „Ehe, Liebe und Sexualität sollten in Kombination gelebt werden können.“ Der Reihe nach: Ehe, das sind die Pflichten, näher die notwendigen Dienste zweier vom Leben – im Kapitalismus – mehr oder weniger gebeutelter Individuen, die sich im sog. „Alltag“ – deutlicher: bei der Reproduktion der Arbeitskraft – gegenseitig unterstützen sollen und den Nachwuchs betreuen. Nebenbei – vielleicht wird im Blick auf diese Seite des Alltags mal eine gewisse Absurdität deutlich und nachvollziehbar: Was Kinder brauchen, an Fürsorge, Zuwendung, an emotionalem und materiellem Aufwand, das ist eine dehnbare, aber doch ziemlich bestimmbare Größe. Diese Betreuung wird, sofern als Ehe und Familie organisiert, mit einer absurden und diesbezüglich völlig unsachlichen Voraussetzung verknüpft – nämlich mit einer romantischen Beziehung der Erzeuger –, sodass die ganze Lebenslage des Kindes affiziert ist, wenn die Erzeuger einander nicht mehr leiden können, bis hin zur Instrumentalisierung im Rahmen sogenannter Rosenkriege. Dass das Kind auch in der Ziehung ist, was die materielle Lage der Eltern betrifft, es also quasi selbstverständlich bestraft wird, wenn die beiden geldmäßig eingeschränkt sind, wenn sie arm sind, ist auch „normal“. Wobei die Erzeuger in der Regel ihre Finanzen nicht wirklich in der Hand haben, weder ob ein Arbeitsplatz gerade ausgefüllt wird oder nicht, und was gegebenenfalls daran verdient wird, und wie sehr das Körper und Geist belastet. Wie gesagt, diese Verknüpfung ist unsachlich und wirkt sich nicht selten sehr abträglich für das vielzitierte Kindeswohl aus, ist aber im Familienrecht ausdrücklich vorgesehen – an der rechtlichen Fixierung merkt man übrigens wieder, dass da keine Naturgesetze am Werk sind.
Dieses alles an ehelichen, nützlichen, sehr unromantischen Diensten und unbezahlter Arbeit sollen sie aus Liebe füreinander erledigen – klar, daran verdienen tun sie ja wirklich nicht, vermutlich könnten sich die beiden ihren Lebensstandard zu Marktpreisen auch nicht leisten. Und die zuletzt erwähnte Sexualität – die „erfüllte“ gilt, nach welchen Kriterien auch immer, heutzutage ohnehin als der übliche, vielleicht der einzige Inbegriff des Glücks –, die muss es erst recht bringen, als der entscheidende Kitt, damit dadurch hoffentlich die Liebe, und darüber dieses strapazierte, fragile Ensemble aus Ansprüchen und Leistungen überhaupt Bestand hat. Die Charakterisierung als das „fatale Ideal der eierlegenden Wollmilchsau“ soll anmerken, dass das alles nicht zusammengeht und nicht zusammengehen kann, es wird auch gern eine „Überforderung“ der Paarbeziehung erwähnt.
Da ist viel dran, aber die Vorstellung eines bloß quantitativen „Zuviel“ drückt sich doch ein wenig um das Bedenken, dass die aufgezählten Momente sich u.U. brutal widersprechen: Dass also gerade wegen der alltäglichen wechselseitigen Pflichten und Mühen nicht selten die Differenzen der Beteiligten wachsen und wegen der wachsenden Unzufriedenheiten die Liebe erodiert; dass der „Alltag“ also die „Romantik“ stört und zerstört; was bekanntlich in den unzähligen diesbezüglichen Ratgebern ständig thematisiert wird. Speziell die Verknüpfung der Versorgung von Kindern mit einer romantischen Beziehung der Erzeuger ist grotesk – in den einschlägigen Statistiken sind das Geld und die Kinder die hauptsächlichen Streitpunkte der Paare. Bleibt die Frage, warum sich die Beteiligten dann nicht halbwegs zivilisiert trennen – was schließlich manchmal doch vorkommt –, sondern warum das nicht selten in die üblichen „Tragödien“ entgleist. Und es bleibt die Frage, warum sich nicht längt allgemein herumgesprochen hat, dass das alles nicht zusammenpasst und zusammengeht … und Leute heiraten noch immer. Woher kommen also die Idealismen und woher kommt die Fallhöhe, die da manchmal im Rosenkrieg, oder in Mord und Totschlag endet?
„Was nun ebenfalls folgte, war die Fokussierung auf das „häusliche Glück“, auf das traute Ehe- und Familienleben und die Kleinfamilie … Hochgesteckte Erwartungen bergen den Keim tiefer Enttäuschung in sich, überzogene Idealvorstellungen lassen die alltägliche Realität bald kümmerlich wirken und degradieren eine unspektakuläre, aber auch nicht sonderlich triste Lebenssituation zu einem Scheitern des eigenen Lebensplans.“ (Tatort Trennung S. 20) (siehe auch S. 24, 25, 27)
Hohe Erwartungen, tiefe Enttäuschungen und – jetzt kommts –, die in einem „Scheitern des Lebensplans“ münden. Soll wieder heißen, da scheitert nicht ein – mehr oder weniger wichtiges – Anliegen, sondern mit diesem speziellen Anliegen scheitert das ganze Leben, der „Lebensplan“. „Enttäuschung“ ist möglicherweise eine zu schwache Formulierung, der Aktivist der Beziehung bzw. der Familie ist ziemlich besessen von der bereits erwähnten Vorstellung, er habe ein Recht auf seine „Erwartungen“, also ein Recht auf die Pflichterfüllung der Gegenseite.
Wenn so manche Lebenspläne scheitern, ist das nicht auf die Beziehung und die Familie beschränkt – eine Entlassung etwa bringt ja auch im Leben so manches durcheinander; aber die gehen, auch wenn sie ganze Belegschaften treffen, normalerweise gewaltfrei über die Bühne. Das heißt dann „sozialer Friede“. Die „Fokussierung“ aller Ideale und Erwartungen auf das „häusliche Glück“ wird oben erwähnt – die lebt wieder von einer ebenso abstrakten wie radikal negativen Einschätzung des Alltags, der alles Mögliche an Befriedigung eben nicht hergibt. Da legen Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft einen brutalen Realismus an den Tag, ohne dass damit eine Kritik am oder eine Absage an den „Alltag“ im Kapitalismus formuliert wäre. Vielmehr und als Ausweg konzentrieren, „fokussieren“ sich offenbar alle möglichen Erwartungen, Glücksansprüche und Sehnsüchte gleich auf die Sphäre des Privatlebens, und führen dann im Fall des Falles einige Erschütterungen herbei, die sich gewaschen haben. Folgt nun der Versuch, von dem, was kaputtgeht, genauer auf das zu schließen, was die Beziehung hätte leisten und liefern sollen.
Die Familie
Ort des Glücks,
Ort der unbezahlten Arbeit,
Ort des Psychoterrors,
Ort des Amoklaufs
Erwartungen und Enttäuschungen, oder:
Selbstwertgefühl – und Ehre!
„Trennungswünsche, vor allem wenn sie eher unerwartet vom Partner in den Raum gestellt werden, sind immer mit extremer Kränkung verbunden, weil sie eine nachhaltige Erschütterung der Selbstdefinition durch einen bedeutsamen anderen darstellen. Wo man sich zuvor noch gebraucht, beheimatet, vielleicht sogar geliebt wähnte, wird nun mitgeteilt, dass man entbehrlich, verzichtbar und überflüssig ist und dass der andere sich sein weiteres Leben sehr gut ohne einen vorstellen kann. Diese Verschiebung der tektonischen Platten unserer Existenz entzieht uns zumindest für eine gewisse Zeit den Boden …“ (TT 51)
Die Selbstdefinition, auch als „Identität“ bekannt, ist erschüttert, was eine „extreme Kränkung“ beinhaltet. Nun ja – vorher war man „gebraucht, beheimatet, vielleicht geliebt“, nachher ist man „entbehrlich, verzichtbar und überflüssig“ – das zweitere geht auch manchem so, wenn er etwa entlassen wird. Der Unterschied ist – „es entzieht uns den Boden“, weil sich die „tektonischen Platten unserer Existenz“ verschieben!? Wenn dem so ist – wovon lebte diese Selbstdefinition denn dann? Man war gebraucht, man war also wichtig – nicht für irgendwen, sondern für die Frau / den Mann, man war geliebt – eine Trennung erschüttert da ohne Zweifel so einiges; vielleicht muss da das ganze Leben beträchtlich umorganisiert werden; ich versuche das mal möglichst sachlich darzustellen. Aber gleich diese komplette Selbstdefinition, also im Grunde die eigene Identität? Vielleicht wird es noch deutlicher in einer Stellungnahme von Mr. Corey Taylor, Sänger und Frontmann von Slipknot:
„Es geht tatsächlich mehr um meine letzte Beziehung … Aber diese Beziehung war extrem giftig – für alle Beteiligten. Es hat lange gedauert, bis ich mich daraus lösen konnte. Und als ich draußen war, sind die Depressionen eskaliert. Ich fühlte ich mich verloren, wusste nicht mehr, wer ich als Person, als Vater, als Mann war. Ich wollte den Hass, den ich aufgrund dieser Beziehung entwickelt hatte, loslassen, denn an der Wut festzuhalten, verletzt dich nur selbst. Aber das konnte ich nicht, bis ich anfing, die Songs für dieses Album zu schreiben und die Wut da hinein zu legen.“ (Kurier 15.2.2020)
Es liest sich, als wäre Mr. Taylor nicht sehr weit weg von der „Beziehungstat“ gewesen – bis er dann sein neues Album geschrieben hat; well done, Mr. Taylor! In dieser Formulierung kommt eine gewisse Absurdität in Sachen Selbstdefinition sehr explizit zum Ausdruck: Er wusste nicht mehr, wer er 1. als Person, 2. als Vater und 3. als Mann war. Man könnte da etwas ironisch weitermachen, und daran erinnern, dass sich an der Person nichts geändert hat, zumindest was die sog. personenbezogenen Daten betrifft, die unters Datenschutzgesetz fallen. Da hätte er nur in seinem Pass nachschauen müssen. Auch die Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen, Bedürfnisse von Corey Taylor dürften nach wie vor gegeben gewesen sein – als Mitglied von Slipknot usw. Ein ihm wichtiges Bedürfnis ist offenbar krachend gescheitert – die Beziehung war giftig, er konnte sich lange nicht lösen. Mr. Taylor interpretiert das nun so, dass nicht etwas, sondern dass er als Person, als Vater und als Mann insgesamt und überhaupt gescheitert ist; besser, er interpretiert das nicht nur so, sondern er erlebt das so, es ergreift ihn, es übermannt ihn und macht ihn fertig: Er wusste nicht mehr, wer er war. Was er bisher über sich und von sich, als Person, als Vater, als Mann geglaubt hatte, ist zerstört. Anders gesagt – seine eigene bisherige Selbstdefinition fällt ihm brutal auf den Kopf.
Die Rede ist von etwas, was in der Regel als das Selbstwertgefühl bezeichnet wird. Auch mit „Selbstdefinition“ und „Selbstbewusstsein“ ist etwas ähnliches gemeint – gemeint ist aber eben nicht die triviale Tatsache, dass man ein Bewusstsein seiner selbst hat, im Unterschied zur Umgebung, man weiß, wer man ist. Gemeint ist, dass man eine gute, womöglich eine hervorragende Meinung von sich selbst hat, dass man sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für erfolgreich und daher auch zurecht für allgemein angesehen hält. Es geht um eine entscheidende Akzentuierung dessen, was Mr. Taylor formuliert, wenn er sagt, er „fühlte sich verloren, er wusste nicht mehr, wer er war, als Person, Vater und Mann“ – gemeint ist nämlich, er wusste nicht mehr, ob er als Person, Vater, Mann auch wirklich so erfolgreich war, so wie er es sich bis dahin eingebildet hat. Es hat sich zwar an ihm, an seiner Person – sowohl an seinen Fähigkeiten, Kompetenzen etc. als auch an seinen Bedürfnissen – nichts geändert, er hat aber offenkundig sein Selbstwertgefühl, das gehobene Selbstbewusstsein, die Selbsteinschätzung, dass er einer sei, der letztlich das Leben meistert, der „was drauf hat“, im weitesten Sinn – das hat er an der Beziehung festgemacht und verloren.
Offenbar hat einer modernen Beziehung die Familie bzw. dadurch das jeweilige Gspusi die hohe, edle und geradezu existentielle Aufgabe, den entscheidenden, letztgültigen Beweis des Erfolgs im Leben abzuliefern, auf den der Partner doch wohl ein Recht hat, weil er doch seinerseits auch „alles“ für sie zu tun bereit ist. Psychologischen Interpretationen besagen, dass man sich so ein Selbstwertgefühl in der Kindheit einfängt oder auch nicht, und dann sein Lebtag damit versorgt ist – oder eben nicht. Im richtigen Leben geht es anders zu, da kämpfen Leute bewusst und als Daueranstrengung darum, sich selbst zu beweisen, wie toll sie nicht sind, und das nicht nur im Berufs-, sondern offenbar bevorzugt und letztgültig im Privatleben. Deswegen ist so ein Beziehungsende auch die ultimative, die nicht hinnehmbare Demütigung und Demolierung der kompletten Persönlichkeit, für die sich dann mancher rächt. Die Leute verteidigen ihr Recht auf ihre Selbstachtung. Alles, was an ihnen respektabel, liebenswert ist – Mann, Vater, Kamerad, Sex-Partner, überhaupt die eigene Attraktivität als Person – das ganze Ich ist ihnen bestritten. Das wird gelebt und erlebt. Und ab und an vergolten, wenn der abstruse Selbstbetrug durch die Trennung auffliegt.
„Die Annahme, betrogen zu werden, geht einher mit der Annahme, nicht so einzigartig, liebens- und begehrenswert zu sein, wie man sich das wünscht, sodass sich die Eifersucht vor allem als Bestätigung mangelnden Werts, als Ausfluss fehlenden Selbstwerts und damit als Angriff auf die Basis der psychischen Funktionsfähigkeit und inneren Stabilität darstellt. Die Abwehr diese Angriffs kann über mehr oder weniger reife Mechanismen erfolgen; einer davon ist die Entwertung des anderen, der einen „nicht verdient“ hat, der Zuneigung oder Liebe gar nicht wert war und der es bisher meisterlich verstanden hat, seinen schlechten Charakter zu verbergen, auf dass der arglose Partner ihm sein Vertrauen schenke. … ein leider nicht so seltener Weg ist die Vernichtung desjenigen, der mich über seinen Betrug entwertet und gedemütigt hat: … Die Wahrscheinlichkeit, zum Mordopfer zu werden, ist in Beziehungen am höchsten, vier Fünftel aller Tötungsdelikte …“ (78f.)
Was die Beziehung, also die Partnerin, hätte leisten sollen: „einzigartig, liebens- und begehrenswert zu sein“, das wird eben umgekehrt zur „Bestätigung mangelnden Werts, des fehlenden Selbstwerts“ – und das ist nichts weniger als ein „Angriff auf die Basis der psychischen Funktionsfähigkeit und inneren Stabilität“: soll heißen, sie macht „alles“ kaputt, denn sie macht ihn kaputt. Weil offenbar ihre praktische, als Beziehung existierende Anerkennung und ihre Bewunderung das Fundament seiner psychischen Stabilität war, auf die er ein Recht hat – und die ist weg. „Ein leider nicht so seltener Weg ist die Vernichtung desjenigen, der mich über seinen Betrug entwertet und gedemütigt hat“ – da kommt ein entscheidender Schritt: Die Wirkung der Trennung auf den damit gescheiterten Selbstbewusstseinspflegefall – entwertet, gedemütigt zu sein –, die wird als Absicht genommen, was nicht unbedingt der Fall ist, vielleicht will die nunmehrige Ex sich bloß vertschüssen –, als absichtlicher Angriff auf die moralische Integrität: Wieder liegt ein Verbrechen vor.
Was auffällt, ist, dass auch Frau Kastner es offenbar für die naturwüchsige, selbstverständliche, in diesem Sinn für die beziehungslogische Folge einer Trennung hält, dass zuerst damit die psychische Funktionsfähigkeit ihre Basis verloren hat, und nachher mehr oder weniger reife Mechanismen greifen, um damit umzugehen. Wie denn bloß, wenn psychische Stabilität und Funktionsfähigkeit tangiert sind? Leute, die ihr Leben damit insgesamt als misslungen und missraten ansehen, vollstrecken dieses Urteil manchmal an dem Verursacher und vielleicht an sich: die täglich gemeldeten Familiendramen. All diese Barbareien sind Formen, in denen das Streben nach Glück und das Recht auf Glück gegen den praktischen Verlauf dieses Strebens festgehalten werden – und der Glückssucher diesem seinem höchsten Zweck manchmal gegen sein wirkliches Dasein Recht gibt, wenn mit der Beziehung die entscheidende Bastion seines Glücksstrebens fällt: Mord und Selbstmord. Ihr Selbstbild – das ist übrigens dasselbe wie ihre Ehre – vertreten sie gewalttätig. Das Selbstwertgefühl ist die psychologisierte Variante der Ehre. Als Fachausdruck für diese Figuren hat sich „Narzissmus“ eingebürgert:
Narzissten, also Menschen, die blindlings von ihrer Unentbehrlichkeit und Großartigkeit überzeugt sind, (sind) besonders anfällig für die „Überraschung“ einer unerwartet angekündigten Trennung … Natürlich sind aber Narzissten, die im Kern immer extrem selbstunsicher sind (wobei dieser Kern bisweilen so tief verborgen liegt, dass sie ihn selbst gar nicht mehr erkennen), auch äußerst anfällig für Angriffe gegen ihr Selbstbild und werden darauf mit einem Vernichtungswillen reagieren, dem jedes Maß abhanden gekommen ist. (51/52)
Narzissten: „Blindlings überzeugt von ihrer Unentbehrlichkeit und Großartigkeit“ oder „extrem selbstunsicher“ – ja was denn nun? Von „blindlings“ kann doch nicht die Rede sein – es ist ja offensichtlich gerade die Aufgabe der Beziehung, die eigenen Selbstwert-Einbildungen zu bestätigen – und im Fall der Trennung liegt eben der Anschlag darauf vor. Was da als Narzissmus benannt wird, ist nichts anderes als die entgleiste – aber durchaus auch von der Psychologie anerkannte! – „Erwartung“ an die „Beziehung“: Die soll einem ja die Einzigartigkeit, Liebenswertigkeit und Begehrenswertigkeit beweisen, und auf diesen Beweis hat man wegen eigener Dienste ein Recht, weswegen die Schuldfrage ansteht …